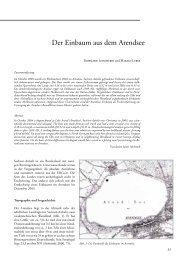Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zwei eng nebeneinanderliegenden <strong>Häuser</strong>n bestätigten,<br />
denen in gleicher Bauflucht wohl ein drittes Gebäude zugesellt<br />
war, dessen Befunde jedoch nur rudimentär erhalten<br />
sind. Zwei Teilbereiche der <strong>Häuser</strong> 1 und 2 wurden auf<br />
insgesamt 127 qm flächig aufgedeckt. Die Grabungen erfassten<br />
lediglich die obersten Lagen der durch vielfache<br />
Fußbodenerneuerungen mächtig aufgeschichteten Hausplätze.<br />
Haus 1 umfasst insgesamt acht Holzfußböden. Die<br />
Gebäude sind zweiräumig. Haus 1 hat zudem einen Vorplatz,<br />
im Rückraum befindet sich ein Kuppelofen (Abb.<br />
2). Die aus Holzfußböden, Pfosten, Wandelementen, Lehmestrichlagen<br />
und organischen Abfallschichten aufgebauten<br />
Befunde der ebenerdig auf Niedermoor errichteten<br />
<strong>Häuser</strong> erwiesen sich durch Transgressionen rundum abgespült<br />
und von Mudden überlagert. Die Befunde sind<br />
bereits abschließend vorgelegt (STROBEL 2000a), so dass<br />
sich hier eine detaillierte Beschreibung erübrigt.<br />
Im Gegensatz zu den etwa zeitgleichen Siedlungen Riedschachen<br />
II, Taubried I und Ehrenstein mit etwa 20<strong>–</strong>40<br />
Gebäuden handelt es sich bei Alleshausen-Hartöschle um<br />
einen <strong>kleine</strong>n, aus nur zwei bis drei <strong>Häuser</strong>n bestehenden<br />
Weiler (Abb. 3). Die vielfache Erneuerung der Fußböden<br />
zeigt dabei eine gewisse Kontinuität der Nutzung. Zur<br />
Zeit der Schussenrieder Kultur dürfte das nördliche Federseeried<br />
nur von dieser Kleinsiedlung belegt worden sein.<br />
2.3 Datierung und Fundmaterial<br />
Holzbauteile aus Eiche und Buche, insbesondere aus den<br />
unteren Fußbodenlagen 2 und 3 des Hauses 1 ergaben<br />
dendrochronologische Waldkantendaten zwischen 3920<br />
und 3916 v. Chr. (BILLAMBOZ 1998, 165). Zudem liegt ein<br />
14 C-Datum aus einem über diesen Böden liegenden Eichenbrett<br />
vor: HD 9509<strong>–</strong>9275 5345±30BP, 4315<strong>–</strong>4046<br />
BC cal.<br />
Die <strong>kleine</strong>n Sondageflächen haben ein vielfältiges und reiches<br />
Fundmaterial erbracht. Dieses ist insbesondere mit<br />
seinem verzierten wie unverzierten Keramikspektrum,<br />
aber auch mit Hirschgeweih-Tüllenfassungen, einem zugehörigen<br />
Knieholm und einer Spitzklinge aus Rijckholt-<br />
Feuerstein der Oberschwäbischen Gruppe der Schussenrieder<br />
Kultur zuweisbar. Die Funde umfassen ferner Mahlsteine<br />
und Läufer, Beilklingen, Klopfsteine, Geweihhacken,<br />
Knochen- und Holzgeräte sowie zahlreiche Netz-<br />
senker. Das Fundmaterial wurde von Strobel (2000a, 174<br />
ff.) ausführlich vorgelegt und diskutiert.<br />
3. Bad Buchau-Torwiesen II<br />
3.1 Topographie<br />
Abb. 3 Rekonstruktionsskizze der <strong>kleine</strong>n Siedlung<br />
Alleshausen-Hartöschle, ein Weiler der Schussenrieder<br />
Kultur (Zeichnung H. Schlichtherle).<br />
In den „Torwiesen“ nördlich des mittelalterlichen Straßendammes<br />
von Kappel nach Buchau liegt das Gelände der<br />
Siedlung Torwiesen II (Stadt Bad Buchau, Lkr. Biberach)<br />
auf den Parzellen 2268/1 und 2260. Es ist dies die Engstelle<br />
zwischen dem Festland und der mineralischen Insel<br />
Buchau, die in der mittleren Bronzezeit und in der Eisenzeit<br />
von Bohlenwegen und einem Packwerkweg überspannt<br />
war (BILLAMBOZ 1997; HEUMÜLLER 1998; dies.<br />
2002). Die endneolithische Siedlung liegt stratigraphisch<br />
unter diesen Wegen etwa in der Mitte zwischen Festland<br />
und Insel, jeweils ca. 300<strong>–</strong>400 m von den Moorrändern<br />
entfernt. Sie ist nach dem aktuellen Stand der Grabungen<br />
an drei Seiten von Muddeablagerungen umgeben. Die Frage,<br />
ob es sich hier bereits zur Siedlungszeit um eine Halbinsel-<br />
oder Insellage handelte, harrt noch der Klärung.<br />
Die Dorfstrasse der Siedlung hat eine ähnliche Orientierung<br />
wie die metallzeitlichen Überwege, so dass vermutet<br />
werden kann, dass die Ortschaft ebenfalls an einer Wegverbindung<br />
auf die Insel Buchau angelegt war. Die Siedlung<br />
orientiert sich jedoch vor allem auf die Festlandseite, was<br />
durch stabile Pfostenbauweise des Weges in westliche<br />
Richtung verdeutlicht wird.<br />
3.2 Grabung und Befunde<br />
Die 1996 im Zuge von systematischen Bohrungen auf der<br />
Trasse der metallzeitlichen Bohlenwege entdeckte Siedlung<br />
wird von uns seit 1997 im Zuge einer Rettungsgrabung<br />
im Bauerwartungsland des Moorheilbades Bad<br />
Buchau erforscht. Das Siedlungsareal ist zum augenblicklichen<br />
Zeitpunkt bereits weitgehend ausgegraben. Die Arbeiten<br />
decken die Baubefunde durch Feinpräparation auf,<br />
die Einzelfunde werden eingemessen. Durch PVC-Röhren<br />
stellen wir in jedem Quadratmeter Rasterproben für Phosphatuntersuchungen<br />
und die quantitative Analyse von<br />
pflanzlichen Großresten und Insekten sicher. Tierknochen<br />
werden wie Funde behandelt. Eine Siebung von Kultur-<br />
15