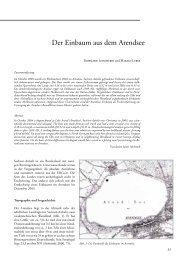Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schichtmaterialien erfolgt lediglich in Sonderfällen, vor allem<br />
wenn Streuungen kalzinierter Knochenpartikel vorliegen.<br />
Die archäologischen und naturwissenschaftlichen<br />
Analysearbeiten haben erst in Teilbereichen der Siedlung<br />
begonnen. Es liegen erste botanische und phosphatanalytische<br />
Ergebnisse (SCHLICHTHERLE/VOGT/HERBIG 2002;<br />
HERBIG 2002) vor. Mehrere Vorberichte unterrichten bereits<br />
ausführlicher über die archäologischen Ergebnisse<br />
(HOHL/SCHLICHTHERLE 1999; BILLAMBOZ/HOHL/<br />
SCHLICHTHERLE 2000; SCHLICHTHERLE 2001; SCHLICHT-<br />
HERLE/HOHL 2002). Hier soll eine Kurzfassung genügen:<br />
Die Siedlungsbefunde liegen auf Niedermoortorf und werden<br />
von einem mächtigen Torfkörper überdeckt (Abb. 5).<br />
Unmittelbar über den Siedlungsruinen und in diesen wurzelnd<br />
wuchs ein Bruchwald dessen zahlreiche Baumstubben<br />
sich bei der Grabung vorfanden. Die in der Regel nur<br />
dünn ausgeprägte, vom umgebenden Torf makroskopisch<br />
oft nicht unterscheidbare Kulturschicht wird am Siedlungsrand<br />
im Norden, Nordosten und Westen der Siedlung<br />
von einer Transgressionsmudde überlagert. Im Bereich<br />
der Bebauung gibt es hingegen keine sedimentologischen<br />
Überflutungshinweise.<br />
Es wurde die komplette Siedlung mit 12 Großhäusern und<br />
2<strong>–</strong>3 Kleinhäusern aufgedeckt (Abb. 4). Die <strong>Häuser</strong> reihen<br />
sich beidseits einer Strasse auf, von der im Westen Begleitpfosten<br />
und im Zentrum des Siedlungsareals Reste der<br />
Bohlenwegskonstruktion erhalten sind. Bei den Großhäusern<br />
handelt es sich um zwei und einschiffige Pfostenbauten<br />
mit mehrlagigem Fußbodenaufbau, die ziemlich regelhaft<br />
mit einem zentralen Feuerstellenbereich ausgestattet<br />
sind und mit Vorplätzen an die Dorfstrasse anbinden. Die<br />
Böden sind zumeist ohne Estrich, die Feuerstellen hingegen<br />
lehmgebaut und scheinen<strong>–</strong> nach einigen Funden angeziegelter<br />
Lehmkuppel(?)fragmente <strong>–</strong> auch Kuppelöfen<br />
umfasst zu haben. Weitere Lehmlinsen weisen auf den partiellen<br />
Einsatz von Lehm im Wandbau hin. Mehrfach<br />
scheinen die hinteren Hausabschlüsse mit Lehm verkleidet<br />
gewesen zu sein. Die Längswände waren, wie Pfostenpaare<br />
und alternierend stehende Pfosten andeuten, wohl vor allem<br />
mit horizontal eingeschichteten Hölzern gebaut (Pfostenstangenwände,<br />
Bretterwände?). In Haus 13 nach hinten<br />
herausgebrochene Stirnwandteile lassen dünne Palisadenwände<br />
in den Giebelflächen vermuten. Die Kleinhäuser<br />
sind einfacher konstruiert und haben lediglich einen<br />
zweifachen, aber sehr stabil gebauten Bodenaufbau (Abb.<br />
6) mit dickem Lehmestrichbelag (Abb. 4), <strong>kleine</strong> Feuerstellen<br />
und nur wenige Pföstchen in den Außenwänden.<br />
Die Befunde der Groß- und Kleinhäuser ähneln konstruktiv<br />
somit denen von Seekirch-Stockwiesen (s. unten), zeigen<br />
im Gegensatz zu diesen aber noch mehr Lehmbauweise.<br />
Die Grabungen brachten einige Abfallkonzentrationen neben<br />
den Hauseingängen zum Vorschein. Hinweise auf eine<br />
siedlungsumgebende Palisade liegen bislang nicht vor. Das<br />
Siedlungsumfeld wird derzeit noch genauer untersucht. Es<br />
liegt somit ein endneolithisches Straßendorf vor, dessen<br />
bauliche Organisation der etwa 300 Jahre jüngeren Siedlung<br />
Seekirch-Achwiesen in hohem Maße gleicht. Hinwei-<br />
Abb. 6 Bad Buchau-Torwiesen II. Das Kleinhaus<br />
14 im Zuge der Ausgrabung 2001 (Foto W. Hohl).<br />
se auf ein Brandereignis im Siedlungsareal gibt es nicht.<br />
Der klare Baubefund ohne Bauüberlagerungen und das<br />
geringe Fundaufkommen sprechen für die Einphasigkeit<br />
der Anlage, der eine Lebensdauer von nur wenigen Jahren<br />
bis Jahrzehnten zugebilligt werden kann.<br />
3.3 Datierung und Fundmaterial<br />
Eichenpfähle der <strong>Häuser</strong> 1 und 3 erbrachten dendrochronologische<br />
Waldkantendaten auf 3293 und 3281 v. Chr.<br />
(BILLAMBOZ/HOHL/SCHLICHTHERLE 2000 u. mündl. Mitt.<br />
A. BILLAMBOZ, Dendrochronologisches Labor Hemmenhofen).<br />
Die Pfähle der anderen <strong>Häuser</strong> (meist Esche) und<br />
auch ihre durchweg aus verschiedenen Laubhölzern, jedoch<br />
niemals aus Eiche gebauten Bodenkonstruktionen<br />
entziehen sich vorläufig noch einer genauen Datierung.<br />
Die dendrochronologischen Untersuchungen sind im<br />
Rahmen einer Dissertation in Arbeit.<br />
Das Fundmaterial umfasst eine vor allem aus Kochtöpfen<br />
bestehende Siedlungsware (Abb. 7). Die Töpfe sind dickwandig,<br />
meist etwas gebaucht mit einziehendem Rand. Es<br />
finden sich aber auch s-förmig geschweifte Topfprofile, die<br />
zusammen mit gelegentlich vorkommender Schlickrauhung<br />
eine Verbindung zur vorausgehenden Pfyn-Altheimer<br />
Gruppe Oberschwabens erkennen lassen. Die Töpfe<br />
sind teilweise mit Einstichreihen unter dem Rand, teils<br />
auch mit Knubben verziert. In wenigen Fällen kommen<br />
frei auf die Gefäßwand aufgesetzte Leistensegmente vor.<br />
Daneben gibt es <strong>kleine</strong> Becher und Schalen sowie Tassen<br />
mit Ösen bzw. Henkelöse. Hinzu kommen zahlreiche<br />
scheibenförmige und konische Spinnwirtel. Das Keramik-<br />
17