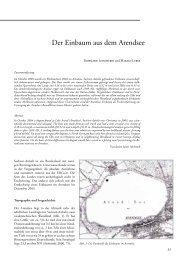Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Für Taubried I konnte Strobel (2000b) durch Analyse der<br />
Bauphasen aufzeigen, dass die zweizelligen <strong>Häuser</strong> aus<br />
einzelligen Anfängen hervorgegangen waren. Dort kamen<br />
erste Siedlungspioniere am Platz zunächst mit 10<strong>–</strong>15 qm<br />
Grundfläche aus, die sie dann allerdings im Laufe von zwei<br />
bis drei Umbauphasen in zweizellige Wohn- und Wirtschaftseinheiten<br />
ausbauten, unter Zugewinn von 1:3 bis<br />
1:1 an Fläche. Über die wirtschaftlichen Verhältnisse der<br />
Siedlung ist leider wenig bekannt. Im Fundmaterial sind<br />
Mahlsteine nachweisbar, Bertsch (1931, 31) berichtete<br />
von einem Vorratsfund mit verkohltem Getreide. Zusammen<br />
mit den regelhaft auftretenden Backöfen kann so eine<br />
agrarische Wirtschaftsweise erschlossen werden, deren<br />
Verhältnis zu jägerisch-sammlerischen Elementen, die<br />
durch zahlreiche Netzsenker nachzuweisen sind, aber<br />
nicht zu gewichten ist. Vermutlich spielte Jagd wie in anderen<br />
Schussenrieder Siedlungen eine beträchtliche Rolle<br />
(STEPPAN in diesem Band).<br />
Besser ist es nun um die <strong>kleine</strong> <strong>Häuser</strong>gruppe von Alleshausen-Hartöschle<br />
bestellt. Dort sind für ähnlich <strong>kleine</strong>,<br />
zwei- bis dreiräumige <strong>Häuser</strong> von 13<strong>–</strong>20 qm Grundfläche<br />
<strong>–</strong> also Einheiten etwa der halben Größe des durchschnittlichen<br />
Ehrensteinhauses <strong>–</strong> zwar Öfen und Mahlsteine nachgewiesen<br />
und umfangreiche botanische Nachweise eines<br />
Getreideanbaus erbracht (MAIER in diesem Band), doch<br />
zeigen die Tierknochenspektren viel Jagdfauna und keinen<br />
sicheren Beleg eines Haustieres (STEPPAN in diesem Band).<br />
Nachweise für Sammeltätigkeit sind indessen eher gering.<br />
Da sommerliche wie winterliche Aktivitäten nachweisbar<br />
sind, kann es sich bei dieser <strong>kleine</strong>n <strong>Häuser</strong>gruppe nicht<br />
um eine saisonale Nebensiedlung der bekannten, größeren<br />
Siedlungen des südlichen Federseeriedes handeln. Vielmehr<br />
dürften hier Siedlungspioniere für eine gewisse Zeit<br />
ansässig geworden sein, wobei es ihnen nicht gelang, die<br />
<strong>kleine</strong> Gemeinschaft zu einem Dorf auszubauen. Nehmen<br />
wir die Größe der <strong>Häuser</strong> als Maßstab für die Betriebsgröße,<br />
so handelt es sich im Gegensatz zu Aichbühl, Riedschachen<br />
II und Ehrenstein bei Täschenwiesen und Taubried<br />
um ärmlichere Bauern mit lediglich der Hälfte des Betriebsvolumens.<br />
Leider wissen wir wenig über die Inventare der <strong>Häuser</strong> von<br />
Dullenried. Immerhin hat Bertsch (1931, 46 f.) ein <strong>kleine</strong>s<br />
Kulturpflanzenspektrum festgestellt, eine quantitative<br />
Wertung ist jedoch nicht möglich. Zudem liegen Geräte<br />
zur Textilproduktion, aber keine Mahlsteine und keine<br />
klaren Erntemeser vor. Wiederum sind hier die Jagdanteile<br />
sehr hoch (STEPPAN in diesem Band). Den Siedlern stand<br />
aufgrund der besonderen topographischen Situation nur<br />
die Insel Buchau als Ackerland zur Verfügung. Diese böte<br />
mit etwa 40 ha zwar ausreichend Anbaufläche für eine größere<br />
Siedlung, doch sind die Möglichkeiten auf der langschmalen<br />
Insel beschränkt. Alle andern Ufersiedlungen<br />
des Federsees orientieren sich nicht an dieser Insel. Es<br />
dürfte deshalb auszuschließen sein, dass in Dullenried mit<br />
der Absicht gesiedelt wurde, eine größere Dorfgemeinschaft<br />
zu gründen. Der Siedlungsplatz scheint vielmehr im<br />
Hinblick auf Fischfang und Jagd ausgewählt und bot hierzu<br />
ideale Bedingungen. Hier sind also weniger Pioniere,<br />
sondern Randgruppen der neolithischen Gesellschaft mit<br />
vorwiegend wildbeuterischer Orientierung zu vermuten.<br />
Ob ganzjährig oder temporär gesiedelt wurde, wissen wir<br />
nicht.<br />
Einen besonderen und äußerst spannenden Fall einer Siedlung<br />
mit Kleinhäusern haben wir mit Alleshausen-Grundwiesen<br />
aufgetan. Sehen wir von den völlig ungeklärten<br />
Hinweisen auf einen Pfostenbau der mittleren Bauphasen<br />
im Siedlungszentrum einmal ab, so sind hier innerhalb einer<br />
Palisade zahlreiche einzellige Kleinhäuser in leichter<br />
Bauweise belegt. Die botanischen Großrestuntersuchungen<br />
(MAIER in diesem Band) lassen eine Spezialisierung auf<br />
Leinanbau erkennen, wohingegen Getreidebau aufgrund<br />
äußerst geringer Pollen- und Dreschreste kaum belegbar<br />
ist. Botanische und insektenkundliche Untersuchungen<br />
(SCHMIDT in diesem Band) sprechen für die Anhäufung<br />
von Tierdung in der Siedlung, der Fund einer Radscheibe<br />
bezeugt den Einsatz von Zugrindern, das Tierknochenspektrum<br />
bietet jedoch nur wenige Belege für Haustierhaltung<br />
bei großer Dominanz der Jagdtiere (STEPPAN in diesem<br />
Band). Keine andere Siedlung in Südwestdeutschland<br />
hat bislang auch nur annähernd so dicke Lagen eines Materials<br />
ergeben, das wohl zu großen Anteilen Tierdung enthielt.<br />
Hier gab es also Herdenhaltung, wobei die Siedler<br />
selbst vor allem Jagdbeute verzehrten sowie eine Spezialisierung<br />
der Siedler auf Textilfaserproduktion unter Verzicht<br />
auf Getreideanbau. Getreide beschaffte man sich<br />
zum Verzehr von außerhalb. Es ist eher unwahrscheinlich,<br />
dass unter diesen Voraussetzungen eine Siedlungsgemeinschaft<br />
autonom wirtschaftete, es sei denn, sie wusste sich<br />
durch ihre Produkte im Austausch mit anderen Siedlungen<br />
zu behaupten. Wahrscheinlicher scheint hier der Fall einer<br />
Nebensiedlung mit hohem Spezialisierungsrad vorzuliegen,<br />
deren Hauptsiedlung reguläre Landwirtschaft betrieb.<br />
Abb. 53 Straßendörfer<br />
am Lac de Chalain,<br />
Ostfrankreich. Chalain<br />
3,VIII: Horgener<br />
Kultur; Chalain 3,II:<br />
Gruppe „Clairvaux<br />
ancien“ (nach PÉTRE-<br />
QUIN 1997, 310).<br />
51