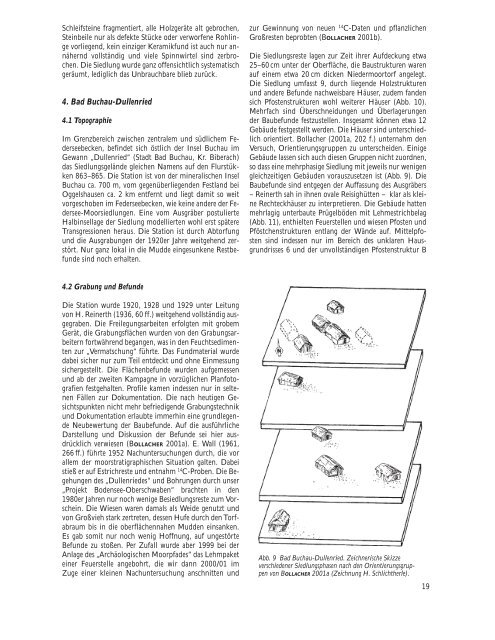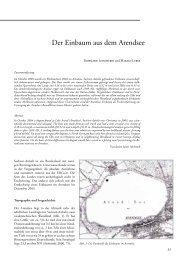Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schleifsteine fragmentiert, alle Holzgeräte alt gebrochen,<br />
Steinbeile nur als defekte Stücke oder verworfene Rohlinge<br />
vorliegend, kein einziger Keramikfund ist auch nur annähernd<br />
vollständig und viele Spinnwirtel sind zerbrochen.<br />
Die Siedlung wurde ganz offensichtlich systematisch<br />
geräumt, lediglich das Unbrauchbare blieb zurück.<br />
4. Bad Buchau-Dullenried<br />
4.1 Topographie<br />
Im Grenzbereich zwischen zentralem und südlichem Federseebecken,<br />
befindet sich östlich der Insel Buchau im<br />
Gewann „Dullenried“ (Stadt Bad Buchau, Kr. Biberach)<br />
das Siedlungsgelände gleichen Namens auf den Flurstükken<br />
863<strong>–</strong>865. Die Station ist von der mineralischen Insel<br />
Buchau ca. 700 m, vom gegenüberliegenden Festland bei<br />
Oggelshausen ca. 2 km entfernt und liegt damit so weit<br />
vorgeschoben im Federseebecken, wie keine andere der Federsee-Moorsiedlungen.<br />
Eine vom Ausgräber postulierte<br />
Halbinsellage der Siedlung modellierten wohl erst spätere<br />
Transgressionen heraus. Die Station ist durch Abtorfung<br />
und die Ausgrabungen der 1920er Jahre weitgehend zerstört.<br />
Nur ganz lokal in die Mudde eingesunkene Restbefunde<br />
sind noch erhalten.<br />
4.2 Grabung und Befunde<br />
Die Station wurde 1920, 1928 und 1929 unter Leitung<br />
von H. Reinerth (1936, 60 ff.) weitgehend vollständig ausgegraben.<br />
Die Freilegungsarbeiten erfolgten mit grobem<br />
Gerät, die Grabungsflächen wurden von den Grabungsarbeitern<br />
fortwährend begangen, was in den Feuchtsedimenten<br />
zur „Vermatschung“ führte. Das Fundmaterial wurde<br />
dabei sicher nur zum Teil entdeckt und ohne Einmessung<br />
sichergestellt. Die Flächenbefunde wurden aufgemessen<br />
und ab der zweiten Kampagne in vorzüglichen Planfotografien<br />
festgehalten. Profile kamen indessen nur in seltenen<br />
Fällen zur Dokumentation. Die nach heutigen Gesichtspunkten<br />
nicht mehr befriedigende Grabungstechnik<br />
und Dokumentation erlaubte immerhin eine grundlegende<br />
Neubewertung der Baubefunde. Auf die ausführliche<br />
Darstellung und Diskussion der Befunde sei hier ausdrücklich<br />
verwiesen (BOLLACHER 2001a). E. Wall (1961,<br />
266 ff.) führte 1952 Nachuntersuchungen durch, die vor<br />
allem der moorstratigraphischen Situation galten. Dabei<br />
stieß er auf Estrichreste und entnahm 14 C-Proben. Die Begehungen<br />
des „Dullenriedes“ und Bohrungen durch unser<br />
„Projekt Bodensee-Oberschwaben“ brachten in den<br />
1980er Jahren nur noch wenige Besiedlungsreste zum Vorschein.<br />
Die Wiesen waren damals als Weide genutzt und<br />
von Großvieh stark zertreten, dessen Hufe durch den Torfabraum<br />
bis in die oberflächennahen Mudden einsanken.<br />
Es gab somit nur noch wenig Hoffnung, auf ungestörte<br />
Befunde zu stoßen. Per Zufall wurde aber 1999 bei der<br />
Anlage des „Archäologischen Moorpfades“ das Lehmpaket<br />
einer Feuerstelle angebohrt, die wir dann 2000/01 im<br />
Zuge einer <strong>kleine</strong>n Nachuntersuchung anschnitten und<br />
zur Gewinnung von neuen 14 C-Daten und pflanzlichen<br />
Großresten beprobten (BOLLACHER 2001b).<br />
Die Siedlungsreste lagen zur Zeit ihrer Aufdeckung etwa<br />
25<strong>–</strong>60 cm unter der Oberfläche, die Baustrukturen waren<br />
auf einem etwa 20 cm dicken Niedermoortorf angelegt.<br />
Die Siedlung umfasst 9, durch liegende Holzstrukturen<br />
und andere Befunde nachweisbare <strong>Häuser</strong>, zudem fanden<br />
sich Pfostenstrukturen wohl weiterer <strong>Häuser</strong> (Abb. 10).<br />
Mehrfach sind Überschneidungen und Überlagerungen<br />
der Baubefunde festzustellen. Insgesamt können etwa 12<br />
Gebäude festgestellt werden. Die <strong>Häuser</strong> sind unterschiedlich<br />
orientiert. Bollacher (2001a, 202 f.) unternahm den<br />
Versuch, Orientierungsgruppen zu unterscheiden. Einige<br />
Gebäude lassen sich auch diesen Gruppen nicht zuordnen,<br />
so dass eine mehrphasige Siedlung mit jeweils nur wenigen<br />
gleichzeitigen Gebäuden vorauszusetzen ist (Abb. 9). Die<br />
Baubefunde sind entgegen der Auffassung des Ausgräbers<br />
<strong>–</strong> Reinerth sah in ihnen ovale Reisighütten <strong>–</strong> klar als <strong>kleine</strong><br />
Rechteckhäuser zu interpretieren. Die Gebäude hatten<br />
mehrlagig unterbaute Prügelböden mit Lehmestrichbelag<br />
(Abb. 11), enthielten Feuerstellen und wiesen Pfosten und<br />
Pföstchenstrukturen entlang der Wände auf. Mittelpfosten<br />
sind indessen nur im Bereich des unklaren Hausgrundrisses<br />
6 und der unvollständigen Pfostenstruktur B<br />
Abb. 9 Bad Buchau-Dullenried. Zeichnerische Skizze<br />
verschiedener Siedlungsphasen nach den Orientierungsgruppen<br />
von BOLLACHER 2001a (Zeichnung H. Schlichtherle).<br />
19