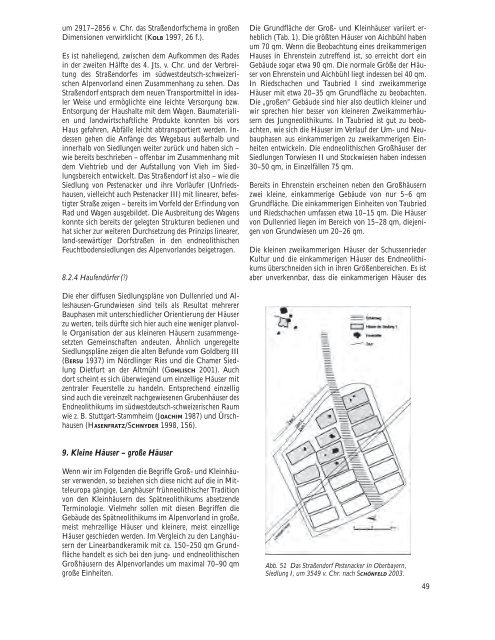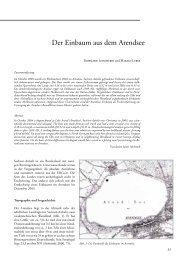Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
um 2917<strong>–</strong>2856 v. Chr. das Straßendorfschema in großen<br />
Dimensionen verwirklicht (KOLB 1997, 26 f.).<br />
Es ist naheliegend, zwischen dem Aufkommen des Rades<br />
in der zweiten Hälfte des 4. Jts. v. Chr. und der Verbreitung<br />
des Straßendorfes im südwestdeutsch-schweizerischen<br />
Alpenvorland einen Zusammenhang zu sehen. Das<br />
Straßendorf entsprach dem neuen Transportmittel in idealer<br />
Weise und ermöglichte eine leichte Versorgung bzw.<br />
Entsorgung der Haushalte mit dem Wagen. Baumaterialien<br />
und landwirtschaftliche Produkte konnten bis vors<br />
Haus gefahren, Abfälle leicht abtransportiert werden. Indessen<br />
gehen die Anfänge des Wegebaus außerhalb und<br />
innerhalb von Siedlungen weiter zurück und haben sich <strong>–</strong><br />
wie bereits beschrieben <strong>–</strong> offenbar im Zusammenhang mit<br />
dem Viehtrieb und der Aufstallung von Vieh im Siedlungsbereich<br />
entwickelt. Das Straßendorf ist also <strong>–</strong> wie die<br />
Siedlung von Pestenacker und ihre Vorläufer (Unfriedshausen,<br />
vielleicht auch Pestenacker III) mit linearer, befestigter<br />
Straße zeigen <strong>–</strong> bereits im Vorfeld der Erfindung von<br />
Rad und Wagen ausgebildet. Die Ausbreitung des Wagens<br />
konnte sich bereits der gelegten Strukturen bedienen und<br />
hat sicher zur weiteren Durchsetzung des Prinzips linearer,<br />
land-seewärtiger Dorfstraßen in den endneolithischen<br />
Feuchtbodensiedlungen des Alpenvorlandes beigetragen.<br />
8.2.4 Haufendörfer(?)<br />
Die eher diffusen Siedlungspläne von Dullenried und Alleshausen-Grundwiesen<br />
sind teils als Resultat mehrerer<br />
Bauphasen mit unterschiedlicher Orientierung der <strong>Häuser</strong><br />
zu werten, teils dürfte sich hier auch eine weniger planvolle<br />
Organisation der aus <strong>kleine</strong>ren <strong>Häuser</strong>n zusammengesetzten<br />
Gemeinschaften andeuten. Ähnlich ungeregelte<br />
Siedlungspläne zeigen die alten Befunde vom Goldberg III<br />
(BERSU 1937) im Nördlinger Ries und die Chamer Siedlung<br />
Dietfurt an der Altmühl (GOHLISCH 2001). Auch<br />
dort scheint es sich überwiegend um einzellige <strong>Häuser</strong> mit<br />
zentraler Feuerstelle zu handeln. Entsprechend einzellig<br />
sind auch die vereinzelt nachgewiesenen Grubenhäuser des<br />
Endneolithikums im südwestdeutsch-schweizerischen Raum<br />
wie z. B. Stuttgart-Stammheim (JOACHIM 1987) und Ürschhausen<br />
(HASENFRATZ/SCHNYDER 1998, 156).<br />
9. Kleine <strong>Häuser</strong> <strong>–</strong> große <strong>Häuser</strong><br />
Wenn wir im Folgenden die Begriffe Groß- und Kleinhäuser<br />
verwenden, so beziehen sich diese nicht auf die in Mitteleuropa<br />
gängige, Langhäuser frühneolithischer Tradition<br />
von den Kleinhäusern des Spätneolithikums absetzende<br />
Terminologie. Vielmehr sollen mit diesen Begriffen die<br />
Gebäude des Spätneolithikums im Alpenvorland in große,<br />
meist mehrzellige <strong>Häuser</strong> und <strong>kleine</strong>re, meist einzellige<br />
<strong>Häuser</strong> geschieden werden. Im Vergleich zu den Langhäusern<br />
der Linearbandkeramik mit ca. 150<strong>–</strong>250 qm Grundfläche<br />
handelt es sich bei den jung- und endneolithischen<br />
Großhäusern des Alpenvorlandes um maximal 70<strong>–</strong>90 qm<br />
große Einheiten.<br />
Die Grundfläche der Groß- und Kleinhäuser variiert erheblich<br />
(Tab. 1). Die größten <strong>Häuser</strong> von Aichbühl haben<br />
um 70 qm. Wenn die Beobachtung eines dreikammerigen<br />
Hauses in Ehrenstein zutreffend ist, so erreicht dort ein<br />
Gebäude sogar etwa 90 qm. Die normale Größe der <strong>Häuser</strong><br />
von Ehrenstein und Aichbühl liegt indessen bei 40 qm.<br />
In Riedschachen und Taubried I sind zweikammerige<br />
<strong>Häuser</strong> mit etwa 20<strong>–</strong>35 qm Grundfläche zu beobachten.<br />
Die „großen“ Gebäude sind hier also deutlich <strong>kleine</strong>r und<br />
wir sprechen hier besser von <strong>kleine</strong>ren Zweikammerhäusern<br />
des Jungneolithikums. In Taubried ist gut zu beobachten,<br />
wie sich die <strong>Häuser</strong> im Verlauf der Um- und Neubauphasen<br />
aus einkammerigen zu zweikammerigen Einheiten<br />
entwickeln. Die endneolithischen Großhäuser der<br />
Siedlungen Torwiesen II und Stockwiesen haben indessen<br />
30<strong>–</strong>50 qm, in Einzelfällen 75 qm.<br />
Bereits in Ehrenstein erscheinen neben den Großhäusern<br />
zwei <strong>kleine</strong>, einkammerige Gebäude von nur 5<strong>–</strong>6 qm<br />
Grundfläche. Die einkammerigen Einheiten von Taubried<br />
und Riedschachen umfassen etwa 10<strong>–</strong>15 qm. Die <strong>Häuser</strong><br />
von Dullenried liegen im Bereich von 15<strong>–</strong>28 qm, diejenigen<br />
von Grundwiesen um 20<strong>–</strong>26 qm.<br />
Die <strong>kleine</strong>n zweikammerigen <strong>Häuser</strong> der Schussenrieder<br />
Kultur und die einkammerigen <strong>Häuser</strong> des Endneolithikums<br />
überschneiden sich in ihren Größenbereichen. Es ist<br />
aber unverkennbar, dass die einkammerigen <strong>Häuser</strong> des<br />
Abb. 51 Das Straßendorf Pestenacker in Oberbayern,<br />
Siedlung I, um 3549 v. Chr. nach SCHÖNFELD 2003.<br />
49