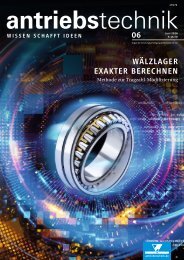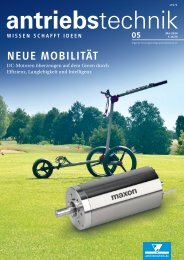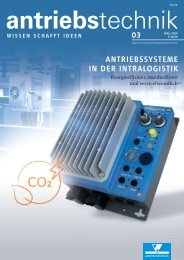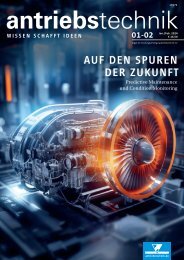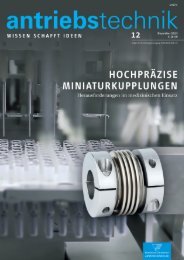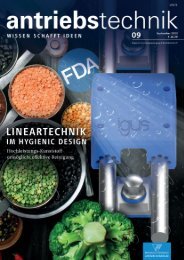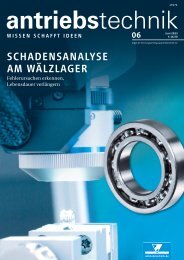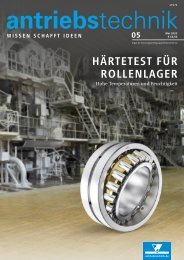antriebstechnik 1-2/2017
antriebstechnik 1-2/2017
antriebstechnik 1-2/2017
- TAGS
- antriebstechnik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mitte symmetrisches Profil ein. Ebenfalls ist ein identisches Profil<br />
für die obere und untere Schiene zu erwarten, weshalb auch hier<br />
die Anbringung an einer der Schienen genügt. Die Temperaturmessung<br />
wird an folgenden Stellen durchgeführt:<br />
n ein Umgebungssensor neben dem Prüfstand<br />
n drei Sensoren entlang des Trägers<br />
n drei Sensoren entlang der oberen Profilschiene<br />
n jeweils ein Sensor an den Stirnseiten der oberen Profilschiene<br />
n ein Sensor am Lager<br />
n ein Sensor am oberen Schuh<br />
n ein Sensor am oberen Spannblock<br />
Dabei kommen zwei Arten von Temperatursensoren zum Einsatz.<br />
Längs der Profilschiene wird aus Platzgründen auf schlanke Thermoelemente<br />
zurückgegriffen, deren Gesamtfehler nach [4] folgendermaßen<br />
angegeben wird:<br />
An den restlichen Temperaturstellen befinden sich Pt100-Elemente<br />
der Klasse A. Deren Fehler beträgt [5]:<br />
Analyse unterschiedlicher Einflussfaktoren<br />
Um den Einfluss der unterschiedlichen Faktoren auf den Wärmeeintrag<br />
des Führungssystems klassifizieren zu können, müssen<br />
unterschiedliche Ausführungen von Profilschienen untersucht<br />
werden. Variiert werden demnach die Baugröße, die Vorspannklasse,<br />
der Schmierstoff und die Art der Wälzkörper. Außerdem<br />
wird der Einfluss der Komponententemperatur und des Abstreifers<br />
tiefergehend analysiert. Alle hier genannten Einflüsse werden zudem<br />
bei vier externen Belastungen (0, 5, 10 und 15 kN) untersucht.<br />
Da die Komponenten vom Hersteller bereits eingefahren geliefert<br />
werden, ist ein Einfahrprozess nicht notwendig. Aus den oben genannten<br />
zu untersuchenden möglichen Einflüssen ergibt sich eine<br />
Anzahl aus Reibkraftkennlinien, die im Zuge der Versuchsdurchführung<br />
aufgenommen werden müssen. Sechs Komponentenausführungen<br />
hinsichtlich Baugröße, Vorspannklasse, Schmierung<br />
und Wälzkörper kombiniert mit zwei Komponententemperaturen<br />
(Raumtemperatur, Temperatur bei Dauerbetrieb), zwei Abstreiferkonstellationen<br />
(mit, ohne) und vier Belastungsfällen (0 kN, 5 kN,<br />
10 kN, 15 kN) ergeben insgesamt 96 Stribeck-Kurven.<br />
Versuchsauswertung und Vergleich<br />
Durch die Translation der Verfahreinheit werden die verspannten<br />
Schuhe über die Profilschiene bewegt und die entstehende Reibkraft<br />
über einen Kraftsensor detektiert. Dazu wird die Maschine<br />
CNC gesteuert mit unterschiedlichen Vorschubgeschwindigkeiten<br />
von 0,001 m/min bis 60 m/min verfahren.<br />
Zusätzlich zu der Aufnahme der Stribeck-Kurven ist auch die<br />
konkrete Temperaturverteilung innerhalb der Komponenten zu<br />
untersuchen. Diese dienen insbesondere der Validierung des später<br />
aufgezeigten Prognosemodells. Dazu werden Dauerversuche durchgeführt<br />
und das Temperaturfeld mithilfe der Pt100-Elemente aufgenommen.<br />
Der Prüfstand wird dabei über 8 h mit einer konstanten<br />
Vorschubgeschwindigkeit von 30 m/min verfahren. Danach befindet<br />
sich der Prüfstand im Stillstand, wobei die Sensoren das Temperaturfeld<br />
weiterhin aufzeichnen und somit Informationen bzgl. der<br />
Abkühlkurve vorliegen.<br />
Profilschienenführungen werden in Bearbeitungsprozessen zumeist<br />
instationär beansprucht. Zur Umsetzung des dargestellten<br />
Ansatzes ist hierzu die Konstanz der Reibkraftcharakteristik zu zeigen.<br />
Dies wird im ersten Schritt für die Komponententemperatur<br />
durchgeführt. Bei Beginn eines Dauerversuchs liegt die Temperatur<br />
der Komponenten bei Raumtemperatur. Nach 8 h Dauerversuch<br />
ergibt sich ein höheres Temperaturniveau. Bild 02 zeigt, dass der<br />
Einfluss der Komponententemperatur als vernachlässigbar einzustufen<br />
ist. Das Diagramm zeigt den Verlauf der Reibkraft über der<br />
Komponententemperatur, welche an der Führungsschiene vorliegt<br />
(23 °C bis 32 °C). Für den technisch relevanten Temperaturbereich<br />
von 20 °C bis 35 °C kann die Reibkraft also als temperaturunabhängig<br />
angesehen werden. Die gezeigte Charakteristik ergibt sich für alle<br />
untersuchten Komponenten im gleichen Maße.<br />
Als zweiten Einfluss wird die Baugröße der Profilschienenführung<br />
variiert. Hierzu werden in Bild 03 die Versuchsergebnisse für<br />
die Baugrößen 35 und 45 gegenübergestellt. Aufgrund der größeren<br />
Wälzkörper und größeren Abstreifer liegen die Reibkräfte der größeren<br />
Komponente erwartungsgemäß über denen der kleineren<br />
Komponente. Es zeigt sich, dass die Bauform 45 eine Reibkraft aufweist,<br />
die über den Geschwindigkeitsbereich gemittelt um den Faktor<br />
2,4 größer ist als die der Bauform 35. Ein Vergleich der Lastabhängigkeit<br />
zeigt, dass durch die Lasterhöhung auf 10 kN eine um<br />
66 % höhere Reibkraft vorliegt. Die Baugröße weist dementsprechend<br />
einen erheblichen Einfluss auf das Reibverhalten auf.<br />
In einem weiteren Vergleich wird der Einfluss der verwendeten<br />
Wälzkörper untersucht. Dazu werden in Bild 04 die Versuchsergebnisse<br />
von Komponenten mit Rollen und welchen mit Kugeln als<br />
Wälzkörper verglichen. Die jeweiligen Kurven gleicher Wälzkörper<br />
zeigen einen parallelen Verlauf mit konstantem Versatz auf. Die<br />
Form der Wälzkörper bedingt jedoch eine unterschiedliche Charakteristik<br />
bei Variation von Last und Geschwindigkeit:<br />
n Zylinderrollen reagieren empfindlich auf Geschwindigkeitsänderungen.<br />
n Kugeln reagieren empfindlich auf Laständerungen.<br />
Deutlich wird der erste Aspekt an der im Verhältnis zu den Kugeln<br />
gesehen höheren Steigung ∂F R<br />
/∂v der Stribeck-Kurve. Die Reibkraft<br />
steigt hier signifikant um fast 60 N an, während sie bei Kugeln lediglich<br />
um ca. 15 N steigt. Daraus lässt sich schließen, dass bei der Auswahl<br />
der Wälzkörper insbesondere für Schnelllauf-Anwendungen<br />
Kugeln vorzuziehen sind, da sie weniger Reibung und damit auch<br />
weniger Wärme erzeugen. Auf der anderen Seite sind Rollen dann<br />
vorzuziehen, wenn höhere Lasten erwartet werden müssen. Der<br />
Versatz zwischen den beiden Lastfällen 0 kN und 5 kN ist mit ca.<br />
5-10 N deutlich geringer als bei den Kugeln mit ca. 45 N.<br />
Im Vergleich der Schmierstoffe zeigt sich, dass der Schmierstoff<br />
Fett bei gleicher Last eine deutlich größere Reibung aufweist als Öl<br />
(Bild 05). Beide dem Fett zugeordneten Kurven liegen deutlich<br />
über den entsprechenden Kurven für die Ölschmierung. Dabei hat<br />
das Fett sogar einen größeren Einfluss als die zugrunde gelegte<br />
Last. Bei 0 kN Last übersteigt die Reibkraft der fettgeschmierten<br />
Komponente die Reibkraft der ölgeschmierten Komponente bei<br />
10 kN Last. Insgesamt ergibt sich durchschnittlich eine ca. 30 % höhere<br />
Reibkraft, wenn die Profilschienenführung mit Fett betrieben<br />
wird. Dieser Umstand lässt sich mit der Zusammensetzung des<br />
62 <strong>antriebstechnik</strong> 1-2/<strong>2017</strong>