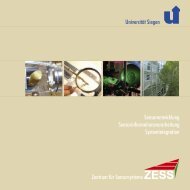Dreidimensionale konfokale Absorptionsmessungen zur räumlichen ...
Dreidimensionale konfokale Absorptionsmessungen zur räumlichen ...
Dreidimensionale konfokale Absorptionsmessungen zur räumlichen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2. Theorie<br />
Sauerstoff-Moleküls ermöglicht es, dass die Energie auf dieses Molekül übertragen werden<br />
kann und es dadurch zu einer Verkürzung der Lebensdauer im T1-Zustand kommt.<br />
Eingehende Untersuchungen zu diesem Wechselspiel findet man in [25].<br />
Photozerstörungen<br />
Durch Photozerstörung der angeregten Moleküle ergibt sich noch ein weiterer Reaktionskanal,<br />
in dem die Moleküle die Anregungsenergie abgeben können. Dabei relaxieren<br />
sie nicht wieder <strong>zur</strong>ück in den elektronischen Grundzustand, sondern reagieren zu Folgeprodukten<br />
ab. Die zuvor absorbierte Energie dient dabei als Aktivierungsenergie dieser<br />
Reaktionen. Maßgeblich wird die Photostabilität eines Farbstoffes davon beeinflusst,<br />
wie oft er im statistischen Mittel einen Anregungs-/Relaxationszyklus durchlaufen kann,<br />
bevor er letztendlich durch diese Photoreaktionen zerstört wird. Für Rhodamine liegt<br />
die durchschnittliche Anzahl von Anregungsprozessen im Bereich von 10 5 Zyklen, bevor<br />
sie irreversibel zerstört werden [28].<br />
2.2. Beschreibung des Grundkonzeptes<br />
Bei dem hier vorgestellten Verfahren <strong>zur</strong> Bildaufnahme handelt es sich um ein Modulationstransfer-Verfahren.<br />
Dabei wird ein mit der Frequenz ωa in seiner Amplitude modulierten<br />
und fokussierten Laserstrahl der Wellenlänge λa (hier als Anregungslaser bezeichnet)<br />
die zu untersuchende Probe beleuchtet. Die Wellenlänge dieses Lasers ist auf<br />
die Absorptionseigenschaften der zu untersuchenden Probe abgestimmt und sollte im<br />
Bereich der Hauptabsorptionsbande des zu untersuchenden Farbstoffes oder Absorbers<br />
liegen.<br />
Diese Bestrahlung bewirkt innerhalb der Probe aufgrund der Modulation eine oszillierende<br />
Besetzung angeregter Molekülzustände. Die zeitliche Abfolge dieser Besetzung<br />
folgt dabei der eingestrahlten Modulationsfrequenz ωa. Das Maß der Besetzung dieser<br />
transienten Zustände ist aber von der <strong>räumlichen</strong> Intensitätsverteilung des Anregungslaserfokus<br />
abhängig.<br />
Diese räumlich inhomogene Besetzung angeregter Molekülzustände innerhalb der Probe<br />
bewirkt in der Regel auch eine Veränderung der Transmissionseigenschaften der Probe,<br />
die aufgrund der hohen Intensität am Ort des Anregungslaserfokus besonders ausgeprägt<br />
ist. Je nach Beobachtungswellenlänge λm kann sich nun eine verringerte oder auch<br />
erhöhte Transmission ergeben. Dies ergibt sich aus der Abhängigkeit, dass die Moleküle<br />
ein verändertes Absorptionsspektrum in ihren angeregten Zuständen zeigen. Aufgrund<br />
der periodischen Anregung oszilliert diese Transmissionsänderung mit der Frequenz der<br />
Anregung.<br />
Diese Veränderung wird nun mit einem zweiten, zum Anregungslaser <strong>konfokale</strong>n Laserstrahl<br />
der Wellenlänge λm (hier als Messlaser bezeichnet) abgefragt. Dieser Messlaserstrahl,<br />
der zunächst in der Intensität unmoduliert ist und auf den gleichen Punkt im<br />
Raum fokussiert wird wie der Anregungslaser, durchleuchtet die Probe und wird durch<br />
die Transmissionsänderung der Probe nun ebenfalls in seiner Intensität moduliert. Die<br />
17