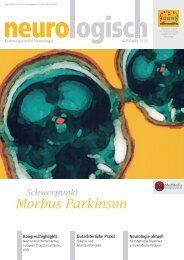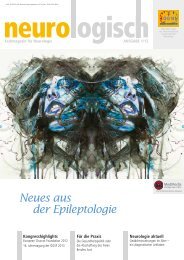Demenzerkrankungen - Österreichische Gesellschaft für Neurologie
Demenzerkrankungen - Österreichische Gesellschaft für Neurologie
Demenzerkrankungen - Österreichische Gesellschaft für Neurologie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
empfohlen. Aufgrund der niedrigen Inzidenz<br />
von intratumoralen Blutungen dürfte eine<br />
Antikoagulation mit keinem Risiko verbunden<br />
sein. Subkutanes Heparinoid und orale<br />
Antikoagulanzien sind die Therapie der Wahl<br />
<strong>für</strong> den Langzeitgebrauch. Bei PatientInnen<br />
mit einem pulmonalen Embolus und einer<br />
nicht symptomatischen tiefen Venenthrombose<br />
kann ein Vena-cava-Filter wirksam sein.<br />
Depression: Die emotionale Belastung einer<br />
Gehirntumordiagnose kann bei PatientInnen<br />
zu Depressionen führen. Die Unterscheidung<br />
von Trauerreaktionen und Depression ist mitunter<br />
schwierig. Zudem erschweren kognitive<br />
und Verhaltensänderungen, die auf den<br />
Tumor zurückzuführen sind, die Diagnosestellung.<br />
Depressionen tragen aber nicht nur<br />
zur emotionalen Belastung und zur Verringerung<br />
die Lebensqualität bei, sondern können<br />
die Überlebenszeit verkürzen. Nach Raison<br />
and Miller 3 besteht ein Benefit bei einer<br />
antidepressiven Therapie. Diskutiert wird aber<br />
auch die Hypothese, dass – aufgrund des Effekts<br />
der Strahlentherapie auf die Neurogenese<br />
– SSRI nach einer Strahlentherapie möglicherweise<br />
nicht wirksam sind.<br />
Künstliche Rehydratation: Oft zeigen sich<br />
Angehörige über die Schluckstörungen in der<br />
terminalen Phase besorgt. Wichtig ist daher,<br />
ausführlich zu erklären, dass die PatientInnen<br />
nicht darunter leiden. Nach Ansicht von<br />
Bavin 4 stellt Durst am Lebensende aufgrund<br />
des proportionalen Verlustes von Natrium<br />
und Flüssigkeit kein Problem dar. Der Nutzen<br />
einer künstlichen Rehydratation ist anekdotisch.<br />
Eine künstliche Rehydratation<br />
kann z. B. Magen- und Lungensekretionen<br />
verursachen, die zu Nausea, Erbrechen und<br />
Verstopfung führen. Zudem kommt es möglicherweise<br />
zu einer Zunahme peritumoraler,<br />
zerebraler und peripherer Ödeme. Andererseits<br />
können sich Aufmerksamkeit und Wohlbefinden<br />
verbessern und dadurch PatientInnen<br />
und Angehörige psychologischen Auftrieb<br />
und Hoffnung erhalten.<br />
Quality Care: Über den gesamten Krankheitsverlauf<br />
ist beim Management der Symptome<br />
und Nebenwirkungen ein multidisziplinärer<br />
Ansatz notwendig. Wesentlich ist<br />
eine gute Kommunikation zwischen dem Gesundheitspersonal<br />
in Spitälern, Hospizen und<br />
Gemeindeeinrichtungen. Oft kommt es außerhalb<br />
der spezialisierten Zentren und palliativen<br />
Einrichtungen wegen mangelnder Erfahrung<br />
mit dieser PatientInnengruppe zu<br />
Problemen bei der Versorgungsplanung. Die<br />
schlechte Prognose der PatientInnen erfordert<br />
jedoch eine lückenlose Betreuung. Es<br />
empfiehlt sich, eine Ansprech- bzw. Kontaktperson<br />
– häufig ein/e spezialisierte/r KrankenpflegerIn<br />
– <strong>für</strong> die PatientInnen, Angehörigen<br />
und die anderen Betreuungspersonen<br />
festzulegen, damit ein Vertrauensverhältnis<br />
mit den PatientInnen und Angehörigen aufgebaut<br />
werden kann. Dies kann auch zu einer<br />
effizienteren Versorgung beitragen.<br />
Informationsangebot: Die NICE-Empfehlungen<br />
5 (National Institute for Health and Clinical<br />
Excellence) betonen, dass klare und präzise<br />
Informationen unerlässlich sind, damit<br />
der/die PatientIn informierte Entscheidungen<br />
über Behandlung und Betreuung treffen<br />
kann. Diese Informationen unterstützen<br />
den/die PatientIn bei einer besseren Kontrolle<br />
der Situation, was sich wieder psychologisch<br />
positiv auswirkt. Eine schlechte Kommunikation<br />
kann ein zusätzlicher Stressfaktor<br />
sein. Allerdings können Dysphasie,<br />
kognitive Einschränkungen und verminderte<br />
Einsicht die Kommunikation und Informationsweitergabe<br />
behindern.<br />
Shanne McNamara<br />
Specialist Nurse Neuro-Oncology,<br />
Edinburgh Centre for Neuro-Oncology, Edinburgh<br />
„It is not always appropriate to ,chase a<br />
cure‘ but to move towards a dignified and<br />
pain free death in a place of choice.“<br />
Woodward 2005<br />
Psychologische Betreuung: Zu den emotionalen<br />
und spirituellen Folgen der Erkrankung<br />
zählen Angst, Wut, Trauer; Einsamkeit<br />
und Schuld. Wie PatientInnen und Angehörige<br />
eine schwerwiegende Diagnose aufnehmen,<br />
ist unvorhersehbar und komplex. PatientInnen<br />
und ihre Familien haben immer<br />
wieder das Bedürfnis, Hoffnung und Sinn zu<br />
finden. Eugene O’Kelly 6 schildert eloquent<br />
seine Reaktion auf die Diagnose Glioblastom.<br />
„Meine Tage ganz oben, energisch und produktiv,<br />
sind vorbei – einfach so“, beschreibt<br />
er die Auswirkungen auf sein Arbeitsleben<br />
und setzt fort mit seinen Gefühlen zur terminalen<br />
Phase seiner Erkrankung. Er habe<br />
keine Wahl als „es zu akzeptieren“ und realisiert,<br />
dass, „wenn man die eigene Angst<br />
bezwingt, bezwingt man auch den eigenen<br />
Tod“.<br />
Der Vortrag von Shanne McNamara fand<br />
während der ÖGN-Jahrestagung 2007,<br />
auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft<br />
Neuropalliation, statt.<br />
Literatur:<br />
1 Lakasing E., Palliative care in primary care. Geriatric<br />
Medicine 2007;37:20-25<br />
2 Junck L., Supportive management in neuro-oncology:<br />
opportunities for patient care, teaching and research.<br />
Current Opinion in Neurology 2004; 17: 649-653<br />
3 Raison C. L. and Miller A. H., Depression in Cancer: New<br />
Developments Regarding Diagnosis and Treatment. Biological<br />
Psychiatry 2003;54: 283-294<br />
4 Bavin L., Artificial rehydration in the last days of life: is it<br />
beneficial? International Journal of Palliative Nursing<br />
2007;13: 445-449<br />
5 National Institute for Health and Clinical Excellence<br />
(2006); Healthcare services for people with brain and<br />
other central nervous system tumours.<br />
6 O’Kelly E. and O’Kelly C., Chasing Daylight: How My<br />
forthcoming death transformed my life. McGraw-Hill<br />
Co. Inc.2006<br />
Weitere Literatur bei der Verfasserin<br />
77