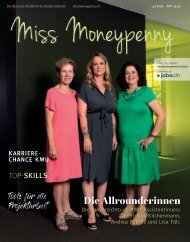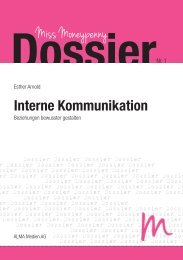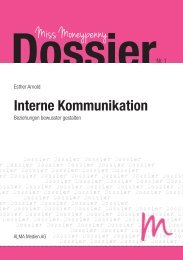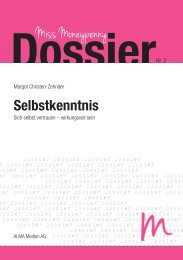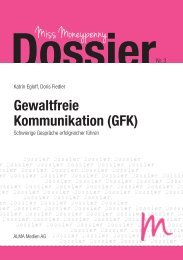HR_Today_6&7_2022
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Arbeit und Recht<br />
THEMA<br />
ursprünglichen Endtermin. Zur Illustration wird<br />
von einem Arbeitsverhältnis ausgegangen, das<br />
unter Einhaltung einer einmonatigen Frist auf<br />
Monatsende gekündigt werden kann. Wird am<br />
15. Mai auf den 30. Juni gekündigt, kommt die<br />
Kündigungsfrist auf den Zeitraum 1. bis 30. Juni<br />
zu liegen. Eine Arbeitsunfähigkeit kann daher erst<br />
ab dem 1. Juni die Sperrfrist auslösen und einen<br />
Unterbruch der Kündigungsfrist bewirken. Ist der<br />
Arbeitnehmende aber während der Kündigungsfrist<br />
arbeitsunfähig, so steht die Kündigungsfrist<br />
während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit still,<br />
solange nicht die Dauer der Sperrfrist überschritten<br />
ist. Ist der Arbeitnehmende also beispielsweise<br />
HABEN SIE FRAGEN ZUM THEMA? ANTWORTEN GIBT ES<br />
AUF <strong>HR</strong> COSMOS,DEM GRÖSSTEN <strong>HR</strong>-WISSENSNETZWERK<br />
DER SCHWEIZ MIT ÜBER 3000 MITGLIEDERN.<br />
<strong>HR</strong>-COSMOS.CH ODER QR-CODE SCANNEN.<br />
vom 11. Juni bis und mit 20. Juni arbeitsunfähig,<br />
steht die Kündigungsfrist während dieser zehn Tage<br />
still und läuft erst am 21. Juni weiter. Das hat zur<br />
Folge, dass die Kündigungsfrist erst 10 Tage später<br />
abläuft, also am 10. Juli statt am 30. Juni. Hinzu<br />
kommt, dass im Beispielfall das Monatsende als<br />
Endtermin festgelegt ist. Deshalb geht das Arbeitsverhältnis<br />
gestützt auf Artikel 336c Absatz 3 OR<br />
nicht am 10. Juli, sondern erst am Monatsende und<br />
somit am 31. Juli zu Ende. Wichtig zu wissen: Eine<br />
weitere Arbeitsunfähigkeit während dieser «zusätzlichen»<br />
Verlängerungsphase aufgrund eines Endtermins<br />
beziehungsweise aufgrund von Artikel 336c<br />
Absatz 3 OR (wie hier vom 11. Juli bis zum 31. Juli)<br />
kann keine Sperrfrist mehr auslösen, zumal die<br />
Kündigungsfrist ja schon abgelaufen ist.<br />
Zusätzliches Kopfzerbrechen kann die folgende<br />
Konstellation bereiten: Eine Arbeitsunfähigkeit,<br />
welche die Kündigungsfrist unterbricht, zieht sich<br />
in das nächste Dienstjahr, für das eine andere<br />
Sperrfrist gilt. Das kann beim Übergang vom<br />
ersten zum zweiten Dienstjahr, oder aber jenem<br />
vom fünften zum sechsten Dienstjahr geschehen<br />
(siehe Tabelle). Hier wird mehrheitlich angenommen,<br />
dass die kürzere Sperrfrist massgebend ist,<br />
wenn die Kündigungsfrist nach dem durch die<br />
Sperrfrist eingetretenen Unterbruch noch im<br />
alten Dienstjahr abläuft. Eine allfällige zusätzliche<br />
Verlängerung aufgrund von Artikel 336c<br />
Absatz 3 OR zum Endtermin bleibt insofern unbeachtlich.<br />
Ist die Kündigungsfrist im alten Dienstjahr<br />
aber noch nicht abgelaufen, kommt die<br />
längere Sperrfrist zum Tragen, wobei die Dauer<br />
der im alten Dienstjahr «verbrauchten» Sperrfrist<br />
angerechnet wird.<br />
a<br />
SÄMTLICHE HAUPT- UND NEBENTÄTIGKEITEN BEIM GLEICHEN<br />
ARBEITGEBENDEN UNTERSTEHEN DEM BVG-OBLIGATORIUM<br />
Rechtsanwältin Sonja<br />
Stark-Traber, LL.M.,<br />
Sozialversicherungsfachfrau<br />
mit eidgenössischem<br />
Fachausweis,<br />
ist Partnerin in der<br />
Wirtschaftsanwaltskanzlei<br />
Suter Howald<br />
Rechtsanwälte in Zürich<br />
und sowohl beratend als<br />
auch prozessierend im<br />
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht<br />
tätig.<br />
suterhowald.ch<br />
BGE 9C_31/2021, Urteil vom 14. April <strong>2022</strong> (zur Publikation<br />
vorgesehen)<br />
Das Urteil<br />
Arbeitnehmer A. war von 2011 bis 2017 als Sozialarbeiter in<br />
einem 100-Prozent-Pensum tätig und bei der BVK Personalvorsorge<br />
des Kantons Zürich in der beruflichen Vorsorge<br />
versichert. In den Jahren 2013 bis 2015 arbeitete er zugleich<br />
in einem geringen Pensum als sozialpädagogischer Familienbegleiter.<br />
Für diese Nebentätigkeit wurden ihm vom Lohn<br />
keine BVG-Beiträge abgezogen. Für beide Tätigkeiten war A.<br />
beim Kanton Zürich angestellt.<br />
A. klagte beim Sozialversichersicherungsgericht des Kantons<br />
Zürich auf Entrichtung der ordentlichen BVG-Beiträge auf<br />
seinem Nebenverdienst. Das Sozialversicherungsgericht wies<br />
die Klage gestützt auf Art. 1j Abs. 1 lit. c BVV2 ab. Nach dieser<br />
Bestimmung sind Arbeitnehmende, die nebenberuflich<br />
tätig und für eine hauptberufliche Erwerbstätigkeit obligatorisch<br />
versichert sind, oder im Hauptberuf eine selbständige<br />
Erwerbstätigkeit ausüben, der obligatorischen Versicherung<br />
gemäss BVG nicht unterstellt. Das Sozialversicherungsgericht<br />
befand, diese Regelung gelte auch im Fall von Mehrfachbeschäftigungen<br />
beim gleichen Arbeitgebenden, die in keinem<br />
Zusammenhang zueinander stünden.<br />
Das Bundesgericht wiederum hiess die von A. gegen den<br />
Entscheid erhobene Beschwerde gut. Grund für den Erlass<br />
von Art. 1j Abs. 1 lit. c BVV2 sei es gewesen, so weit wie möglich<br />
zu verhindern, dass Arbeitnehmende, die im Dienste<br />
mehrerer Arbeitgebenden stehen, für jede Tätigkeit der obligatorischen<br />
beruflichen Vorsorge unterstellt würden. Das<br />
würde bei den beteiligten Vorsorgeeinrichtungen einen nicht<br />
unerheblichen administrativen Aufwand verursachen, der bei<br />
geringfügigen Nebenerwerbstätigkeiten in keinem Verhältnis<br />
zum verbesserten Vorsorgeschutz des Arbeitnehmenden<br />
stünde. Dieser Zweckgedanke komme jedoch nicht zum<br />
Tragen, wenn ein Arbeitnehmender beim gleichen Arbeitgebenden<br />
mehrere Tätigkeiten ausübe. In diesen Fällen sei<br />
jeweils dieselbe Vorsorgeeinrichtung zuständig, womit der<br />
Mehraufwand für die Versicherung kaum ins Gewicht falle.<br />
Weiter sei auch auf die nicht unerhebliche Missbrauchsgefahr<br />
hinzuweisen, die bestünde, wenn die aus verschiedenen Tätigkeiten<br />
erzielten Löhne beim gleichen Arbeitgebenden nicht<br />
kumuliert würden. Ein Arbeitgebender könnte damit durch<br />
Abschluss mehrerer Arbeitsverträge mit demselben Arbeitnehmenden<br />
Arbeitsverhältnisse schaffen, die den Mindestlohn<br />
für die obligatorische Versicherung gemäss BVG nicht erreichen,<br />
und auf diese Weise das BVG-Obligatorium ganz oder<br />
teilweise umgehen.<br />
Daraus folgt gemäss Bundesgericht, dass in Fällen, in denen<br />
ein Arbeitnehmender beim gleichen Arbeitgebenden sowohl<br />
im Haupt- als auch im Nebenerwerb tätig ist, Art. 1j Abs. 1<br />
lit. c BVV2 keine Anwendung findet. Vielmehr sind in diesen<br />
Fällen die erzielten Löhne in Anwendung von Art. 2 Abs. 1 BVG<br />
zusammenzurechnen.<br />
Konsequenz für die Praxis<br />
Soweit ein Arbeitnehmender für seine hauptberufliche Tätigkeit<br />
obligatorisch in der beruflichen Vorsorge versichert ist, unterstehen<br />
allfällige Nebentätigkeiten nicht dem BVG-Obligatorium<br />
(Art. 1j Abs. 1 lit. c BVV2). Falls für die Nebentätigkeit keine freiwillige<br />
Versicherung gemäss Art. 46 BVG abgeschlossen wird,<br />
ist der erzielte Nebenverdienst deshalb nicht BVG-beitragspflichtig.<br />
Das Bundesgericht stellte mit dem vorliegenden Entscheid<br />
jedoch klar, dass das nicht gilt, wenn die Mehrfachbeschäftigung<br />
durch den gleichen Arbeitgebenden erfolgt. In diesem Fall sind<br />
BVG-Beiträge auf dem gesamten Verdienst zu entrichten. Arbeitgebende,<br />
die mehr als ein Arbeitsverhältnis mit dem gleichen<br />
Arbeitnehmenden eingehen, sollten deshalb sicherstellen, dass<br />
die BVG-Beiträge auf dem gesamten Lohn entrichtet werden,<br />
um spätere Nachforderungen zu vermeiden.<br />
a<br />
6&7 | <strong>2022</strong><br />
37