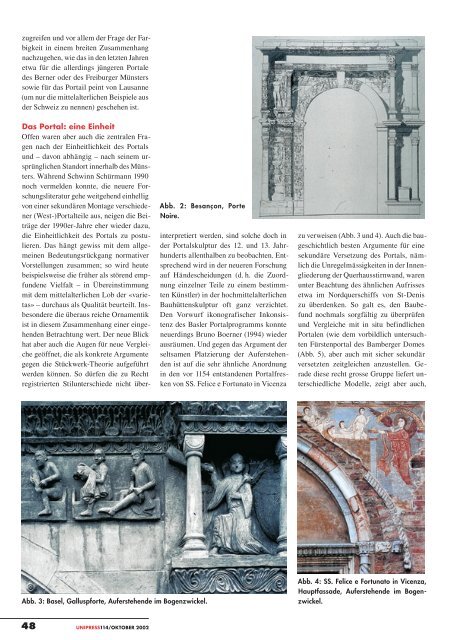114 DAS MITTELALTER - Universität Bern
114 DAS MITTELALTER - Universität Bern
114 DAS MITTELALTER - Universität Bern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zugreifen und vor allem der Frage der Farbigkeit<br />
in einem breiten Zusammenhang<br />
nachzugehen, wie das in den letzten Jahren<br />
etwa für die allerdings jüngeren Portale<br />
des <strong>Bern</strong>er oder des Freiburger Münsters<br />
sowie für das Portail peint von Lausanne<br />
(um nur die mittelalterlichen Beispiele aus<br />
der Schweiz zu nennen) geschehen ist.<br />
Das Portal: eine Einheit<br />
Offen waren aber auch die zentralen Fragen<br />
nach der Einheitlichkeit des Portals<br />
und – davon abhängig – nach seinem ursprünglichen<br />
Standort innerhalb des Münsters.<br />
Während Schwinn Schürmann 1990<br />
noch vermelden konnte, die neuere Forschungsliteratur<br />
gehe weitgehend einhellig<br />
von einer sekundären Montage verschiedener<br />
(West-)Portalteile aus, neigen die Beiträge<br />
der 1990er-Jahre eher wieder dazu,<br />
die Einheitlichkeit des Portals zu postulieren.<br />
Das hängt gewiss mit dem allgemeinen<br />
Bedeutungsrückgang normativer<br />
Vorstellungen zusammen; so wird heute<br />
beispielsweise die früher als störend empfundene<br />
Vielfalt – in Übereinstimmung<br />
mit dem mittelalterlichen Lob der «varietas»<br />
– durchaus als Qualität beurteilt. Insbesondere<br />
die überaus reiche Ornamentik<br />
ist in diesem Zusammenhang einer eingehenden<br />
Betrachtung wert. Der neue Blick<br />
hat aber auch die Augen für neue Vergleiche<br />
geöffnet, die als konkrete Argumente<br />
gegen die Stückwerk-Theorie aufgeführt<br />
werden können. So dürfen die zu Recht<br />
registrierten Stilunterschiede nicht über-<br />
48 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />
Abb. 2: Besançon, Porte<br />
Noire.<br />
Abb. 3: Basel, Galluspforte, Auferstehende im Bogenzwickel.<br />
interpretiert werden, sind solche doch in<br />
der Portalskulptur des 12. und 13. Jahrhunderts<br />
allenthalben zu beobachten. Entsprechend<br />
wird in der neueren Forschung<br />
auf Händescheidungen (d. h. die Zuordnung<br />
einzelner Teile zu einem bestimmten<br />
Künstler) in der hochmittelalterlichen<br />
Bauhüttenskulptur oft ganz verzichtet.<br />
Den Vorwurf ikonografischer Inkonsistenz<br />
des Basler Portalprogramms konnte<br />
neuerdings Bruno Boerner (1994) wieder<br />
ausräumen. Und gegen das Argument der<br />
seltsamen Platzierung der Auferstehenden<br />
ist auf die sehr ähnliche Anordnung<br />
in den vor 1154 entstandenen Portalfresken<br />
von SS. Felice e Fortunato in Vicenza<br />
zu verweisen (Abb. 3 und 4). Auch die baugeschichtlich<br />
besten Argumente für eine<br />
sekundäre Versetzung des Portals, nämlich<br />
die Unregelmässigkeiten in der Innengliederung<br />
der Querhausstirnwand, waren<br />
unter Beachtung des ähnlichen Aufrisses<br />
etwa im Nordquerschiffs von St-Denis<br />
zu überdenken. So galt es, den Baubefund<br />
nochmals sorgfältig zu überprüfen<br />
und Vergleiche mit in situ befindlichen<br />
Portalen (wie dem vorbildlich untersuchten<br />
Fürstenportal des Bamberger Domes<br />
(Abb. 5), aber auch mit sicher sekundär<br />
versetzten zeitgleichen anzustellen. Gerade<br />
diese recht grosse Gruppe liefert unterschiedliche<br />
Modelle, zeigt aber auch,<br />
Abb. 4: SS. Felice e Fortunato in Vicenza,<br />
Hauptfassade, Auferstehende im Bogenzwickel.