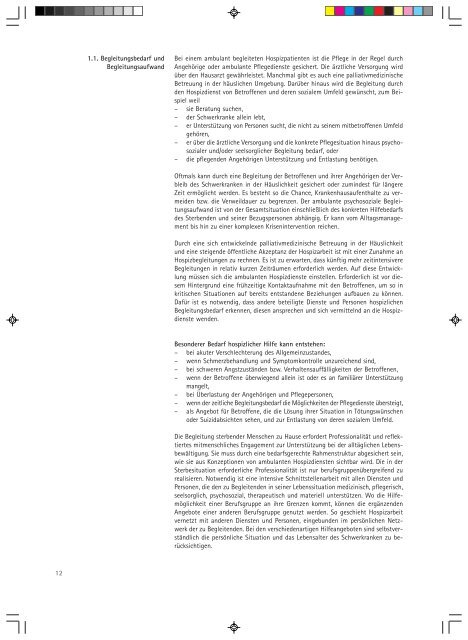Weiterentwicklung von Hospiz - Diakonie Geringswalde
Weiterentwicklung von Hospiz - Diakonie Geringswalde
Weiterentwicklung von Hospiz - Diakonie Geringswalde
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12<br />
1.1. Begleitungsbedarf und<br />
Begleitungsaufwand<br />
Bei einem ambulant begleiteten <strong>Hospiz</strong>patienten ist die Pflege in der Regel durch<br />
Angehörige oder ambulante Pflegedienste gesichert. Die ärztliche Versorgung wird<br />
über den Hausarzt gewährleistet. Manchmal gibt es auch eine palliativmedizinische<br />
Betreuung in der häuslichen Umgebung. Darüber hinaus wird die Begleitung durch<br />
den <strong>Hospiz</strong>dienst <strong>von</strong> Betroffenen und deren sozialem Umfeld gewünscht, zum Beispiel<br />
weil<br />
– sie Beratung suchen,<br />
– der Schwerkranke allein lebt,<br />
– er Unterstützung <strong>von</strong> Personen sucht, die nicht zu seinem mitbetroffenen Umfeld<br />
gehören,<br />
– er über die ärztliche Versorgung und die konkrete Pflegesituation hinaus psychosozialer<br />
und/oder seelsorglicher Begleitung bedarf, oder<br />
– die pflegenden Angehörigen Unterstützung und Entlastung benötigen.<br />
Oftmals kann durch eine Begleitung der Betroffenen und ihrer Angehörigen der Verbleib<br />
des Schwerkranken in der Häuslichkeit gesichert oder zumindest für längere<br />
Zeit ermöglicht werden. Es besteht so die Chance, Krankenhausaufenthalte zu vermeiden<br />
bzw. die Verweildauer zu begrenzen. Der ambulante psychosoziale Begleitungsaufwand<br />
ist <strong>von</strong> der Gesamtsituation einschließlich des konkreten Hilfebedarfs<br />
des Sterbenden und seiner Bezugspersonen abhängig. Er kann vom Alltagsmanagement<br />
bis hin zu einer komplexen Krisenintervention reichen.<br />
Durch eine sich entwickelnde palliativmedizinische Betreuung in der Häuslichkeit<br />
und eine steigende öffentliche Akzeptanz der <strong>Hospiz</strong>arbeit ist mit einer Zunahme an<br />
<strong>Hospiz</strong>begleitungen zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass künftig mehr zeitintensivere<br />
Begleitungen in relativ kurzen Zeiträumen erforderlich werden. Auf diese Entwicklung<br />
müssen sich die ambulanten <strong>Hospiz</strong>dienste einstellen. Erforderlich ist vor diesem<br />
Hintergrund eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Betroffenen, um so in<br />
kritischen Situationen auf bereits entstandene Beziehungen aufbauen zu können.<br />
Dafür ist es notwendig, dass andere beteiligte Dienste und Personen hospizlichen<br />
Begleitungsbedarf erkennen, diesen ansprechen und sich vermittelnd an die <strong>Hospiz</strong>dienste<br />
wenden.<br />
Besonderer Bedarf hospizlicher Hilfe kann entstehen:<br />
– bei akuter Verschlechterung des Allgemeinzustandes,<br />
– wenn Schmerzbehandlung und Symptomkontrolle unzureichend sind,<br />
– bei schweren Angstzuständen bzw. Verhaltensauffälligkeiten der Betroffenen,<br />
– wenn der Betroffene überwiegend allein ist oder es an familiärer Unterstützung<br />
mangelt,<br />
– bei Überlastung der Angehörigen und Pflegepersonen,<br />
– wenn der zeitliche Begleitungsbedarf die Möglichkeiten der Pflegedienste übersteigt,<br />
– als Angebot für Betroffene, die die Lösung ihrer Situation in Tötungswünschen<br />
oder Suizidabsichten sehen, und zur Entlastung <strong>von</strong> deren sozialem Umfeld.<br />
Die Begleitung sterbender Menschen zu Hause erfordert Professionalität und reflektiertes<br />
mitmenschliches Engagement zur Unterstützung bei der alltäglichen Lebensbewältigung.<br />
Sie muss durch eine bedarfsgerechte Rahmenstruktur abgesichert sein,<br />
wie sie aus Konzeptionen <strong>von</strong> ambulanten <strong>Hospiz</strong>diensten sichtbar wird. Die in der<br />
Sterbesituation erforderliche Professionalität ist nur berufsgruppenübergreifend zu<br />
realisieren. Notwendig ist eine intensive Schnittstellenarbeit mit allen Diensten und<br />
Personen, die den zu Begleitenden in seiner Lebenssituation medizinisch, pflegerisch,<br />
seelsorglich, psychosozial, therapeutisch und materiell unterstützen. Wo die Hilfemöglichkeit<br />
einer Berufsgruppe an ihre Grenzen kommt, können die ergänzenden<br />
Angebote einer anderen Berufsgruppe genutzt werden. So geschieht <strong>Hospiz</strong>arbeit<br />
vernetzt mit anderen Diensten und Personen, eingebunden im persönlichen Netzwerk<br />
der zu Begleitenden. Bei den verschiedenartigen Hilfeangeboten sind selbstverständlich<br />
die persönliche Situation und das Lebensalter des Schwerkranken zu berücksichtigen.