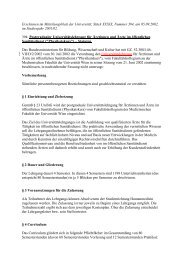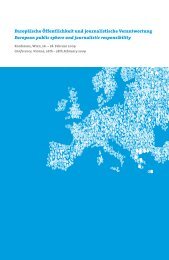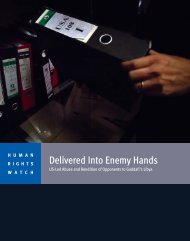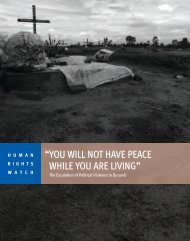(Stand: 25. Juli 2007) ANDERSON, Michael Alan ... - Universität Wien
(Stand: 25. Juli 2007) ANDERSON, Michael Alan ... - Universität Wien
(Stand: 25. Juli 2007) ANDERSON, Michael Alan ... - Universität Wien
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MEDIEVAL & RENAISSANCE MUSIC CONFERENCE <strong>2007</strong> – WIEN, 7.-11. AUGUST ABSTRACTS<br />
source suggests that it is now possible to provide scribe D with a name. This paper examines<br />
the evidence for the new identification and considers some of its possible implications<br />
both for D’s own contribution to the codex and for the history of the source as a<br />
whole.<br />
� �<br />
ZAPKE, Susana (Fundación BBVA, Madrid)<br />
Notationssysteme in der Iberischen Halbinsel, 9.–12. Jahrhundert<br />
Donnerstag/Thursday, 9.8., 18.00 Uhr, KuGe, SR 3<br />
Die mehr oder weniger zeitgleich geführte Transition vom altspanischen- zum fränkischrömischen<br />
Ritus im letzten Viertel des 11. Jh. in den verschiedenen religiösen Zentren der<br />
iberischen Halbinsel wirft ein vielfältiges Bild auf, das sich sowohl auf der formellen wie<br />
auch auf der inhaltlichen Ebene der musikliturgischen Quellen beobachten lässt. Unter<br />
formellen Elementen sind unter anderem die Notationssysteme der diversen kulturellen<br />
Kreise Spaniens zu verstehen, die letztendlich durch die aquitanische Notation – jedoch<br />
nicht vor dem 13. Jh. – ersetzt werden sollten. Eine besondere Aufmerksamkeit widmen<br />
wir in diesem Referat der Koexistenz von Notationssystemen und deren Interaktion vor<br />
dem Hintergrund des liturgischen Reformationsprozesses. Dabei soll verdeutlicht werden,<br />
welch vielfältige Kombinationen, Kontaktphänomene, und welche Zwischenstationen<br />
sich in den jeweiligen Notations-Inventaren widerspiegeln.<br />
� �<br />
ZYWIETZ, <strong>Michael</strong> (Hochschule für Künste Bremen)<br />
Die Chanson des Andreas Pevernage und ihr Gattungskontext<br />
Donnerstag/Thursday, 9.8., 9.45 Uhr, KuGe, SR 1<br />
Die Individualdrucke Pevernages tragen entscheidend zur Blüte der Chanson in den spanischen<br />
Niederlanden bei, die um 1600 zu Ende ging. In den über 100 Chansons Pevernages<br />
setzt sich der fünf- bis achtstimmige Chansonsatz, ebenso wie bei J. de Castro, C.<br />
Verdonk und J. P. Sweelinck, durch. Lange nach dem Ende der Pariser Chanson erreicht<br />
die Gattung in den Werken der genannten Komponisten und insbesondere in den vier<br />
Individualdrucken Pevernages einen Höhepunkt ihrer Entwicklung. In den motettisch<br />
dimensionierten Stücken erfährt das kontrapunktische Stimmengeflecht eine teils madrigalische,<br />
teils von der musique mesurée à l'antique gefärbte und mit großartiger Klangphantasie<br />
ins Werk gesetzte Darstellung des Textdetails. In seinen Chansons sucht und findet<br />
Pevernage den Anschluss an die Innovationen des zeitgenössischen Madrigals. Dass sich<br />
dies in Antwerpen, dem zeitgenössischen Zentrum der Madrigalpublikation außerhalb<br />
Italiens ereignete, erscheint gattungsgeschichtlich folgerichtig. Wie in Deutschland fehlte<br />
auch in den spanischen Niederlanden der literarische Hintergrund, um die Gattung wirklich<br />
einbürgern zu können.<br />
� �<br />
- 81 -