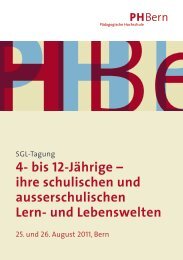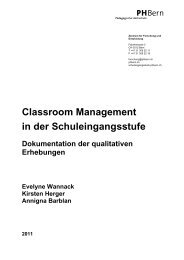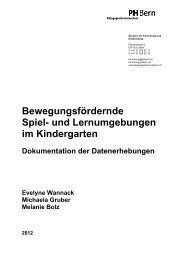Download - Evelyne Wannack
Download - Evelyne Wannack
Download - Evelyne Wannack
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AG 5<br />
„SchülerLeben“:<br />
Biographische und ethnographische<br />
Schülerforschung<br />
Organisation:<br />
Dr. Georg Breidenstein, Halle/Saale<br />
Dr. Rolf-Torsten Kramer, Halle/Saale<br />
Auch wenn Bildungsprozesse längst über die Schule hinausgreifen, muss die allgemeinbildende<br />
Schule (nach wie vor) als diejenige Einrichtung angesehen werden, in<br />
der Bildung und Lernen konzentriert werden, sowohl institutionell als auch biographisch.<br />
Aber wie (er-)leben Kinder und Jugendliche diese Zeit, die Schulzeit? In welches Verhältnis<br />
setzen sie sich zu dem Zweck von Schule, den Lern- und Bildungsprozessen?<br />
Die in dieser Arbeitsgruppe zu diskutierenden Beiträge gehen mit den Mitteln der Ethnographie<br />
und der Biographieanalyse der Frage nach, wie Kinder und Jugendliche mit<br />
Schule und Schulzeit umgehen, und konzentrieren sich dabei auf die Problematik schulischen<br />
Erfolgs und Misserfolgs. Der Versuch der Arbeitsgruppe gilt der konsequenten<br />
Rekonstruktion der Perspektive von Schülerinnen und Schülern auf das schulische<br />
Geschehen. Neben der Präsentation neuerer Arbeiten zu dem angesprochenen Themenfeld<br />
geht es auch um die methodologische Frage nach dem Zusammenhang von<br />
Biographieforschung und Ethnographie: Auf welchen Untersuchungsebenen sind biographieanalytische<br />
und ethnographische Rekonstruktionen jeweils angesiedelt und wie<br />
lassen sie sich verknüpfen? Wie äussert sich Biographie in situierter Handlungspraxis<br />
und wie wird alltägliche Praxis wiederum biographisch verarbeitet?<br />
Till-Sebastian Idel, Mainz:<br />
„Waldorfschule ist im Grossen und Ganzen eher ein rotes Tuch für mich“<br />
– Exemplarische Biographieanalyse einer misslungenen Waldorfkarriere<br />
Prof. Dr. Leonie Herwartz-Emden/Verena Schurt/Wiebke Warburg, Augsburg:<br />
Geschlechterbilder und Schulerfolg von Mädchen im Kontext<br />
einer Mädchenschule<br />
Dr. Christine Wiezorek, Halle/Saale:<br />
Milieubezug, subjektive Lernprobleme und schulische Bildung – Exemplarische<br />
Auszüge aus einer biographischen Fallstudie<br />
Dr. Georg Breidenstein/Michael Meier, Halle/Saale:<br />
„Streber“ – Zum Verhältnis von Peer-Kultur und Schulerfolg<br />
Dr. Rolf-Torsten Kramer, Halle/Saale:<br />
Ambivalenzen schulischer Distinktion – Eine biographieanalytische Perspektive<br />
auf Schulerfolg<br />
Ganztagsschule –<br />
Ganztagsbetreuung –<br />
Ganztagsbildung<br />
Organisation:<br />
Dr. Thomas Coelen, Bielefeld<br />
Welche ganztägigen Bildungssysteme bieten die besten Voraussetzungen für Bildung<br />
über die Lebenszeit? Bildung ist weder nach dem 12./13. Schuljahr beendet noch um<br />
12 oder 13 Uhr! Auffälligerweise wird der Kongress von den erziehungswissenschaftlichen<br />
Spitzenverbänden der einzigen drei europäischen Länder veranstaltet, die keine<br />
ganztägigen Bildungssysteme besitzen. Deshalb erscheint es bildungspolitisch angebracht,<br />
Empirie und Theorie ganztägiger Bildung in einer Arbeitsgruppe zu erörtern.<br />
Neben, vor und nach der Schule leisten nicht nur der Kleinkind- und Vorschulbereich<br />
und die Berufs-, Erwachsenen- und Weiterbildung, sondern auch die ausserschulische<br />
Jugendbildung und die Sozialpädagogik gewichtige Beiträge zur lebenszeitlichen Bildungsfähigkeit.<br />
Deshalb wird die Arbeitsgruppe von dem Vorverständnis geleitet, dass<br />
in Ganztagssystemen ein ausgewogenes Verhältnis von Anteilen formellen und nichtformellen<br />
Lernens gewährleistet sein müsste. Dazu werden Vertreter der drei Veranstaltungsländer<br />
bzw. der betroffenen Teildisziplinen (Allgemeine Erziehungswissenschaft<br />
und Didaktik, Familienforschung, Schulpädagogik und Sozialpädagogik) den jeweiligen<br />
Debatten- und Umsetzungsstand in ihren Bereichen vergleichend diskutieren.<br />
Dr. Thomas Coelen, Bielefeld:<br />
Ganztagsbildung im internationalen Vergleich<br />
Prof. Dr. Tassilo Knauf, Duisburg:<br />
Die schulische Ganztagsentwicklung in Deutschland seit 1970<br />
Prof. Dr. Ulrike Popp, Klagenfurt:<br />
Sozialisatorische, pädagogische, bildungs- und familienpolitische Argumente<br />
für Ganztagssysteme<br />
Prof. Dr. Michael Schratz, Innsbruck:<br />
Zur Diskussion über Ganztagsformen in Österreich<br />
AG 6<br />
lic. phil. Dorothea Tuggener, Zürich:<br />
Die Tagesschuldiskussion in der Deutschschweiz – Entwicklungen, Fortschritte<br />
und Fallstricke<br />
akad. Adj. Beat Wirz, Basel-Landschaft:<br />
Ganztagesschule – mehr Zeit und Raum für eigenaktives und selbstgesteuertes<br />
Lernen<br />
28 Montag, 22.03.04, 15.00 – 18.00 Uhr Montag, 22.03.04, 15.00 – 18.00 Uhr<br />
29