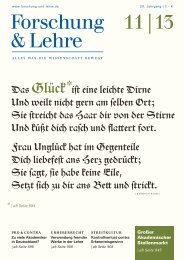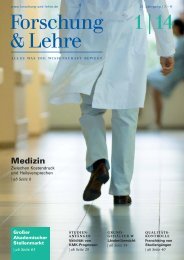2012 - Forschung & Lehre
2012 - Forschung & Lehre
2012 - Forschung & Lehre
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9|12 <strong>Forschung</strong> & <strong>Lehre</strong> WISSENSCHAFT UND WEIN 713<br />
Wie Wörter eine weinsprachliche<br />
Sonderbedeutung erhalten, zeigt mannbar,<br />
ein Weinwort ebenfalls des 19.<br />
Jahrhunderts. Es bedeutete damals ,reif‘<br />
und ,trinkfertig‘. Im Mittelalter hieß<br />
manbære, auf junge Frauen bezogen,<br />
,reif‘ und ,heiratsfähig‘. Dann wurde es<br />
auch von jungen Männern gesagt, die<br />
Extension also erweitert, weshalb die<br />
Bedeutung mit ,erwachsen‘ zu umschreiben<br />
war. Als Weinwort blieb ihm<br />
nur ein Teil der Bedeutung erhalten.<br />
Denn ,heiratsfähig‘ würde beim Wein ja<br />
,zum Verschnitt geeignet‘ bedeuten.<br />
Anders als die Fachleute, die die<br />
Weinsprache als durch Gebrauch festgelegtes<br />
Kommunikationsmittel benutzen,<br />
versuchen Schriftsteller und Journalisten,<br />
mit bildkräftigen Wendungen eine Vorstellung<br />
von schwer fassbaren Geschmacksnuancen<br />
zu vermitteln. Dabei<br />
dürfe man, hat der weinkundige Dichter<br />
Stefan Andres gesagt, „einfach alles“,<br />
doch eines nicht: „Worte aus dem festgelegten<br />
Vokabular falsch benutzen“. Doch<br />
gerade das geschieht sehr oft, weil die<br />
Bedeutungen in der Gemeinsprache vage<br />
und leicht veränderbar sind.<br />
Stile der Weinbeschreibung<br />
Die Unterschiede zeigen sich besonders<br />
deutlich, wenn man Stile der Weinbeschreibung<br />
beobachtet. Der Fachstil<br />
dient der Protokollierung des Probeneindrucks<br />
und verzichtet daher auf alles<br />
Überflüssige. In der Minimalform besteht<br />
er nur aus einem einzigen Wort<br />
wie ausdrucksvoll oder kantig. Daneben<br />
gibt es notizenartige Bewertungen<br />
wie langer Nachhall. Mehr wirkt schon<br />
fast geschwätzig.<br />
In der Praxis werden die Urteile umso<br />
knapper, je mehr die Fachleute unter<br />
sich sind. Auf Preislisten für Endverbraucher<br />
tritt der Werbeaspekt mit<br />
ausführlicheren Beschreibungen hervor.<br />
Dann heißt es beispielsweise rassig,<br />
herb, fruchtige Säure, Schieferton oder<br />
noch ausführlicher hochedel, mit feiner<br />
Frucht und Blume, reife Säure, Beerenton,<br />
auf dem Höhepunkt der Entwicklung,<br />
Zukunft.<br />
Den größten Gegensatz zum Fachstil<br />
bietet ein Stil, der sich an feinsinnige<br />
und gebildete Weintrinker wendet, die<br />
den uneigentlichen Ausdruck zu schätzen<br />
wissen und in ihm ein Mittel zur Erweiterung<br />
der Erfahrung sehen. Charakteristische<br />
Beispiele für diesen poetischen<br />
Stil verdanken wir einem württembergischen<br />
Wein-Grafen. Eine Traminer<br />
Spätlese stellte er seinen Kunden<br />
mit folgenden, durch Rhythmus, Allite-<br />
Do schtellte mä der Kellner de Bulle hänne. Ich frogt’n, ob hä die Sorte<br />
kennen dhät.<br />
„Jo, die äs gut, die schmecket ,fleischig‘.“<br />
„Wie schmecketse, fleischig? Do äs woll Gehacktes drinne?“<br />
„Det is’n Weincharakteristikum“, bemerkete do so’n Berliner Reisender, der<br />
sich newen mich gesetzt hadde und mich angock, als wanne sahn wollde:<br />
Du hast nadierlich keine Ahnunge nit vom Winn.<br />
Ich nahm die Hänne us der Hosenkippe und schbrach: „Ich danke au vor de<br />
Belehrunge. Giwwets dann noch mehr so Charakteristikimmer?“<br />
Do gab hä mä’ne Winn-Breisliste, wo mehr wie hunnert Sorten drof schtannen.<br />
Hinner jeder Sorte schtand was anneres bemerket: „leicht“, „hübsch“,<br />
„elegant“, „zart“, „viel Bouquet“, „mild“, „saftig“, „geschmeidig“, „viel Saft“,<br />
„süß“, „fruchtig“, „krautig“, „kernig“, „edel“, „herb“, „sec“ usw. usw.<br />
Henner Piffendeckel (d.i. Philipp Scheidemann): Im Rotskeller (1910)<br />
ration und Assonanz geadelten Worten<br />
vor: Feinfleischig flitzende Forelle, nackelig<br />
schnalzend im Bach. Die Information<br />
tendiert hier gegen Null, die<br />
sprachliche Veredelung des Weins überwiegt.<br />
Wie der Fachstil zielt auch der Kritikerstil<br />
auf Präzision der Beschreibung,<br />
möchte aber zugleich aus der Weindegustation<br />
eine Wissenschaft machen<br />
und die Beschreibung nobilitieren. Man<br />
findet ihn in der populären Weinliteratur,<br />
die sich bei der Weincharakterisierung<br />
an Menübeschreibungen orientiert.<br />
Eine Moselspätlese wird so charakterisiert:<br />
Tänzerische Vitalität, unglaubliche<br />
Fruchtdichte, dramatische<br />
Abbildung des Moselschiefers.<br />
»Der Fachstil verzichtet<br />
auf alles Überflüssige.«<br />
Hier geht es weniger um eine angemessene<br />
Charakterisierung als um eine<br />
wortreiche Beschreibung. Dazu werden<br />
viele kühne Fügungen benutzt, wenn etwa<br />
von saftig-reifer Dichte oder von ziselierter<br />
Säure, von karamellig-schmelzigem<br />
Abklang oder von kollosaler<br />
Konzentration die Rede ist. Hinter dem<br />
Streben nach Vollständigkeit tritt die<br />
Angemessenheit der Beschreibung zurück,<br />
und hinter einem Wust von Wörtern<br />
gerät der Wein manchmal aus dem<br />
Blick.<br />
Dem Boulevardstil haftet noch ein<br />
Rest von seriöser Weinbeschreibung an,<br />
doch überwiegt das Streben nach Effekt<br />
und einem Ausdruck, der im Zweifelsfall<br />
immer der Wirkung den Vorzug vor<br />
der Angemessenheit gibt. Man findet<br />
diesen Stil besonders in der populären<br />
Weinpresse, die sich im Verkauf gegen<br />
starke Konkurrenz behaupten muss.<br />
Das hat Folgen für die Weinbeschreibung,<br />
bei der die einprägsame, oft<br />
gesuchte Formulierung wichtiger ist als<br />
das Streben nach Wahrheit und Klarheit<br />
des Ausdrucks.<br />
Solche Weinbeschreibungen greifen<br />
Stereotypen der Werbung auf und bestätigen<br />
das propagierte Lebensgefühl.<br />
Ein Rotwein wird dann als ein nach Lagerfeuer<br />
und Waldbeeren duftender<br />
Wein mit ausdrucksstarker Frucht, eleganten<br />
Elementen und viel Temperament<br />
gepriesen. Ihm wird deshalb attestiert:<br />
Scheint auf der Zunge Tango zu<br />
tanzen. Diesen Boulevardstil hat Vincent<br />
Klink, der wortmächtige Fernsehkoch,<br />
als „verbale Verschwurbelung“<br />
und „unerträglich-selbstbesoffene ,Weindichtung‘“<br />
heftig kritisiert und mit grotesken<br />
Beispielen parodiert: Duft nach<br />
Sattelleder, lehmig im Abgang, staubt in<br />
der Hose.<br />
Auf den fachlichen Sonderwortschatz<br />
zur Weinbeschreibung kann man<br />
nicht verzichten, wenn man schnell und<br />
griffig die wichtigsten Eigenschaften<br />
hervorheben will. Obwohl chemische<br />
Analysen vieler Weineigenschaften bequem<br />
durchzuführen sind, kann nur die<br />
Sinnenprobe die Bewertung durch den<br />
Menschen erkunden. Ihr Ausdrucksmittel<br />
ist die Weinsprache. Sie wird darum<br />
ihre Funktion behalten, solange man<br />
Wein als Kulturgut versteht. Dass man<br />
weinsprachliche Beschreibungen wie eine<br />
Partitur genießen kann, selbst wenn<br />
der edle Tropfen nicht im Glase klingt,<br />
hat Carl Zuckmayer in den Jahren des<br />
Kampfes um Anerkennung als Dramatiker<br />
auf den Rand einer Weinkarte geschrieben:<br />
„Karte mit Verstand gelesen,<br />
ist so gut wie voll gewesen.“ Das gilt<br />
auch heute noch.