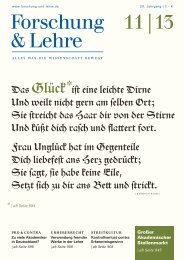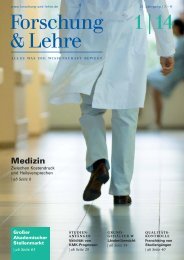2012 - Forschung & Lehre
2012 - Forschung & Lehre
2012 - Forschung & Lehre
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
9|12 <strong>Forschung</strong> & <strong>Lehre</strong> BÜCHER 741<br />
Lesen und<br />
lesen lassen<br />
Ethik geistiger Arbeit<br />
Den aktuellen Hintergrund des Essays<br />
bilden die spektakulären Plagiate<br />
in den Dissertationen von Politikern.<br />
Theisohn geht es aber nicht darum,<br />
die Skandalfälle aufzuarbeiten.<br />
Sein Anspruch greift darüber weit hinaus.<br />
Die Schrift ist eine kulturkritische<br />
Auseinandersetzung mit der Praxis des<br />
literarischen Schreibens in den Bereichen<br />
der Kunst, der Politik und der<br />
Geisteswissenschaft.<br />
Wesentlicher Leitgedanke und Anknüpfungspunkt<br />
der Kritik ist die paradigmatische<br />
Feststellung einer „Entpersönlichung<br />
der Literatur auf der einen<br />
und der Entliterarisierung der Persönlichkeit<br />
auf der anderen Seite“. Dieser<br />
Befund manifestiert sich nach Theisohn<br />
in einer Vielzahl von Phänomenen einer<br />
„Entmenschlichung der Produktion<br />
von Literatur“. Unter dem Blickwinkel<br />
der „Interkontextualität“ befasst er sich<br />
mit dem in der breiten Öffentlichkeit<br />
diskutierten Fällen Hegemann und Tellkamp,<br />
die in ihren Romanen Textpassagen<br />
aus anderen Werken übernommen<br />
haben, was zum Teil zu einem neuen<br />
Genre der Kunst hochstilisiert wurde.<br />
Als Rechtfertigungsgrund, den Theisohn<br />
nachdrücklich zurückweist, wird das<br />
Argument angeführt, dass es „ohnehin<br />
keine Grenzen mehr zwischen Leben<br />
und Schreiben gibt“. Gewagt ist die<br />
These, dass die Dissertationsplagiate<br />
von Politikern ein Indiz für eine umfassende<br />
„Aneignung von geistiger Arbeit“<br />
darstellen. Es werde im Sinne eines unausgesprochenen<br />
Konsenses hingenommen,<br />
dass sie permanent literarisches<br />
Eigentum veruntreuen. Theisohn wendet<br />
sich gegen eine Reduktion der Plagiatskontrolle<br />
durch einen oberflächlichen<br />
maschinisierten Textvergleich im<br />
Internet. Darüber hinaus erblickt er das<br />
Problem vieler wissenschaftlicher Arbeiten<br />
nicht im wissenschaftlichen Fehlverhalten,<br />
sondern darin, dass überhaupt<br />
Texte entstehen, die keinerlei<br />
Substanz besitzen, sondern sich auf reine<br />
Kompilation beschränken. Zustimmung<br />
verdient es, wenn Theisohn im<br />
Rahmen der Behandlung der Open-Access-Problematik<br />
eine gesetzlich ange-<br />
ordnete Übertragung urheberrechtlicher<br />
Verwertungsrechte von wissenschaftlichen<br />
Autoren an die Hochschule nachdrücklich<br />
ablehnt.<br />
Seiner Kritik am Verlust der Individualität<br />
des literarischen Schreibens<br />
stellt Theisohn eine neue Textethik gegenüber,<br />
in deren Mittelpunkt die literarische<br />
Arbeit steht. Ein lesenswertes<br />
Buch, es ist kurz genug,<br />
um es zweimal zu lesen.<br />
Philipp Theisohn: Literarisches<br />
Eigentum. Zur Ethik<br />
geistiger Arbeit im digitalen<br />
Zeitalter. Essay. 137 Seiten,<br />
Verlag Kröner, 11,90 €.<br />
Professor Dr. Horst-Peter Götting<br />
Nicht wegzudenken<br />
Von Büchern und Banknoten bis zu<br />
Zeitungen – die Universalität des<br />
Papiers in allen Lebensbereichen ist offenkundig.<br />
Eine Geschichte dieses Trägermediums<br />
in all seinen Formen und<br />
Funktionen hat nun Lothar Müller, Redakteur<br />
im Feuilleton der Süddeutschen<br />
Zeitung und Honorarprofessor an der<br />
HU Berlin, geschrieben. Sie reicht von<br />
der Herkunft des Papiers aus China bis in<br />
die heutige Zeit, in der die elektronischen<br />
Medien das Papier zu verdrängen scheinen,<br />
und ist immer wieder mit einem<br />
Blick auf die Literatur verknüpft. Die Geschichte<br />
des Papiers umfasst weit mehr<br />
als das gedruckte Papier, und so bettet<br />
der Autor die Gutenberg-Ära in die Epoche<br />
des Papiers ein, um die Gutenbergwelt<br />
besser verständlich zu machen und<br />
Rückschlüsse auf die künftige Bedeutung<br />
des Papiers zu ziehen. Das Papier wird<br />
wohl Schlüsselpositionen verlieren, aber<br />
trotz der rasant fortschreitenden Digitalisierung<br />
weiter notwendig sein. Grund genug,<br />
diesem elementaren<br />
Medium ein facettenreiches<br />
Buch zu widmen.<br />
Lothar Müller: Weiße Magie.<br />
Die Epoche des Papiers. Carl<br />
Hanser Verlag, München<br />
<strong>2012</strong>, 383 Seiten, 24,90 €.<br />
Ina Lohaus<br />
BÜCHER ÜBER<br />
WISSENSCHAFT<br />
Christa Cremer-Renz / Bettina<br />
Jansen-Schulz (Hg.): Von der<br />
Internationalisierung der<br />
Hochschule zur Transkulturellen<br />
Wissenschaft<br />
Nomos Verlag, Baden-Baden<br />
<strong>2012</strong>, 350 Seiten, 64,- €.<br />
DAAD (Hg.): Wissenschaft<br />
Weltoffen <strong>2012</strong><br />
Daten und Fakten zur Internationalität<br />
von Studium und<br />
<strong>Forschung</strong> in Deutschland.<br />
W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld<br />
<strong>2012</strong>, 100 Seiten, 29,90 €.<br />
Daniel Krausnick: Staat<br />
und Hochschule im Gewährleistungsstaat<br />
Verlag Mohr Siebeck, Tübingen<br />
<strong>2012</strong>, 660 Seiten, 114,- €.<br />
Bernd-Olaf Küppers: Die Berechenbarkeit<br />
der Welt<br />
Grenzfragen der exakten Wissenschaften.<br />
Hirzel Verlag, Stuttgart<br />
<strong>2012</strong>, 307 Seiten, 32,- €.<br />
Nadia Primc: Das Verhältnis<br />
von Lebenswelt und Wissenschaft<br />
Verlag Königshausen & Neumann,<br />
Würzburg <strong>2012</strong>, 184 Seiten,<br />
28,- €.<br />
Rainer Scharf: Ausgezeichnete<br />
Physik<br />
Der Nobelpreis und die Geschichte<br />
einer Wissenschaft. Verlag<br />
Bückle & Böhm, Regensburg<br />
<strong>2012</strong>, 303 Seiten, 22,90 €.<br />
Alfred North Whitehead: Die Ziele<br />
von Erziehung und Bildung<br />
Und andere Essays. Suhrkamp<br />
Verlag, Berlin <strong>2012</strong>, 234 Seiten,<br />
14,- €.<br />
Torsten Wilholt: Die Freiheit<br />
der <strong>Forschung</strong><br />
Begründungen und Begrenzungen.<br />
Suhrkamp Verlag, Berlin<br />
<strong>2012</strong>, 372 Seiten 16,- €.