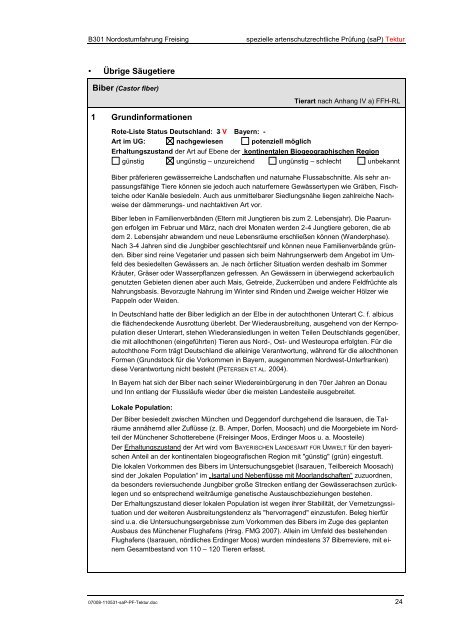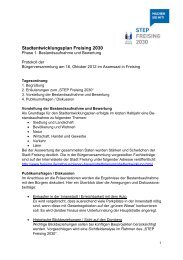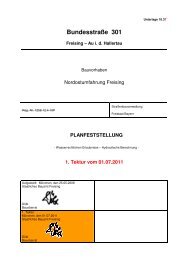Anlage 1 zu Unterlage T1-11 - Stadt Freising
Anlage 1 zu Unterlage T1-11 - Stadt Freising
Anlage 1 zu Unterlage T1-11 - Stadt Freising
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
B301 Nordostumfahrung <strong>Freising</strong> spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) Tektur<br />
• Übrige Säugetiere<br />
Biber (Castor fiber)<br />
1 Grundinformationen<br />
Rote-Liste Status Deutschland: 3 V Bayern: -<br />
Art im UG: nachgewiesen potenziell möglich<br />
Tierart nach Anhang IV a) FFH-RL<br />
Erhaltungs<strong>zu</strong>stand der Art auf Ebene der kontinentalen Biogeographischen Region<br />
günstig ungünstig – un<strong>zu</strong>reichend ungünstig – schlecht unbekannt<br />
Biber präferieren gewässerreiche Landschaften und naturnahe Flussabschnitte. Als sehr anpassungsfähige<br />
Tiere können sie jedoch auch naturfernere Gewässertypen wie Gräben, Fischteiche<br />
oder Kanäle besiedeln. Auch aus unmittelbarer Siedlungsnähe liegen zahlreiche Nachweise<br />
der dämmerungs- und nachtaktiven Art vor.<br />
Biber leben in Familienverbänden (Eltern mit Jungtieren bis <strong>zu</strong>m 2. Lebensjahr). Die Paarungen<br />
erfolgen im Februar und März, nach drei Monaten werden 2-4 Jungtiere geboren, die ab<br />
dem 2. Lebensjahr abwandern und neue Lebensräume erschließen können (Wanderphase).<br />
Nach 3-4 Jahren sind die Jungbiber geschlechtsreif und können neue Familienverbände gründen.<br />
Biber sind reine Vegetarier und passen sich beim Nahrungserwerb dem Angebot im Umfeld<br />
des besiedelten Gewässers an. Je nach örtlicher Situation werden deshalb im Sommer<br />
Kräuter, Gräser oder Wasserpflanzen gefressen. An Gewässern in überwiegend ackerbaulich<br />
genutzten Gebieten dienen aber auch Mais, Getreide, Zuckerrüben und andere Feldfrüchte als<br />
Nahrungsbasis. Bevor<strong>zu</strong>gte Nahrung im Winter sind Rinden und Zweige weicher Hölzer wie<br />
Pappeln oder Weiden.<br />
In Deutschland hatte der Biber lediglich an der Elbe in der autochthonen Unterart C. f. albicus<br />
die flächendeckende Ausrottung überlebt. Der Wiederausbreitung, ausgehend von der Kernpopulation<br />
dieser Unterart, stehen Wiederansiedlungen in weiten Teilen Deutschlands gegenüber,<br />
die mit allochthonen (eingeführten) Tieren aus Nord-, Ost- und Westeuropa erfolgten. Für die<br />
autochthone Form trägt Deutschland die alleinige Verantwortung, während für die allochthonen<br />
Formen (Grundstock für die Vorkommen in Bayern, ausgenommen Nordwest-Unterfranken)<br />
diese Verantwortung nicht besteht (PETERSEN ET AL. 2004).<br />
In Bayern hat sich der Biber nach seiner Wiedereinbürgerung in den 70er Jahren an Donau<br />
und Inn entlang der Flussläufe wieder über die meisten Landesteile ausgebreitet.<br />
Lokale Population:<br />
Der Biber besiedelt zwischen München und Deggendorf durchgehend die Isarauen, die Talräume<br />
annähernd aller Zuflüsse (z. B. Amper, Dorfen, Moosach) und die Moorgebiete im Nordteil<br />
der Münchener Schotterebene (<strong>Freising</strong>er Moos, Erdinger Moos u. a. Moosteile)<br />
Der Erhaltungs<strong>zu</strong>stand der Art wird vom BAYERISCHEN LANDESAMT FÜR UMWELT für den bayerischen<br />
Anteil an der kontinentalen biogeografischen Region mit "günstig" (grün) eingestuft.<br />
Die lokalen Vorkommen des Bibers im Untersuchungsgebiet (Isarauen, Teilbereich Moosach)<br />
sind der „lokalen Population“ im „Isartal und Nebenflüsse mit Moorlandschaften“ <strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnen,<br />
da besonders reviersuchende Jungbiber große Strecken entlang der Gewässerachsen <strong>zu</strong>rücklegen<br />
und so entsprechend weiträumige genetische Austauschbeziehungen bestehen.<br />
Der Erhaltungs<strong>zu</strong>stand dieser lokalen Population ist wegen ihrer Stabilität, der Vernet<strong>zu</strong>ngssituation<br />
und der weiteren Ausbreitungstendenz als "hervorragend" ein<strong>zu</strong>stufen. Beleg hierfür<br />
sind u.a. die Untersuchungsergebnisse <strong>zu</strong>m Vorkommen des Bibers im Zuge des geplanten<br />
Ausbaus des Münchener Flughafens (Hrsg. FMG 2007). Allein im Umfeld des bestehenden<br />
Flughafens (Isarauen, nördliches Erdinger Moos) wurden mindestens 37 Biberreviere, mit einem<br />
Gesamtbestand von <strong>11</strong>0 – 120 Tieren erfasst.<br />
07008-<strong>11</strong>0531-saP-PF-Tektur.doc 24