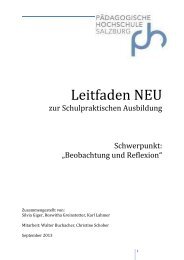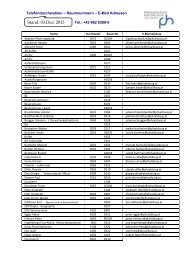Methoden und Entwicklung. Teil 2 - Pädagogische Hochschule ...
Methoden und Entwicklung. Teil 2 - Pädagogische Hochschule ...
Methoden und Entwicklung. Teil 2 - Pädagogische Hochschule ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
94 Praxis<br />
kraft erhalten mehr Klarheit, wie die Schüler ihre Rolle <strong>und</strong> Aufgabe wahrnehmen. Die<br />
Lernenden sind für ihr individuelles Lernen verantwortlich, d.h. sie entscheiden, ob <strong>und</strong><br />
wie sie ein Angebot annehmen.<br />
lm Unterrichtsalltag gibt es selten genügend Freiraum für mündliche individuelle Befragungen,<br />
da der zeitliche Rahmen dafür großzügig gesteckt werden muss. Außerdem<br />
erschwert die häufig fehlende Anonymität den Einsatz dieses Instruments. Daher dominieren<br />
schriftliche Formen. Das gezielte Erfassen von Wahrnehmungen <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
kann offen oder kriteriengeleitet erfolgen. Qualitative Bewertungen von Unterricht<br />
werden eingeholt durch Abfragen, die offene Antworten zulassen; die Feedbackgeber<br />
melden die für sie relevanten Wahrnehmungen nach dem Motto ,,Was fällt mir auf?"<br />
zurück. Das Ergebnis ist häufig ein breites Spektrum von Antworten. Eine systematische<br />
Auswertung <strong>und</strong> die Datenrückmeldung an die Schüler sind schwierig. Oft bleibt eine<br />
Auflistung übrig, die gemeinsam mit der Lerngruppe diskutiert wird. Sinnvoll ist der Einsatz<br />
dieses lnstruments vor allem in kleinen Cruppen.<br />
Eine besondere Form des offenen Feedbacks ist das Salzergänzungsfeedback (Landwehr,<br />
2003). Die vorgegebenen Satzanfänge sollen die Lernenden unterstützen, Wahrnehmungen<br />
zielgerichtet zu formulieren. Mit ,,Hand - persönliche Bilanz" (s.S. 102)<br />
finden Sie im Praxisteil ein Beispiel. Möchten Sie eine quantitative Rückmeldung über<br />
bestimmte Wahrnehmungen einholen, dann setzen Sie einen Fragebogen mit vorgegebenen<br />
Fragen zum Einschätzen ein. Die Antworten werden von lhnen oder den Schülern<br />
ausgezählt, alle positiven <strong>und</strong> negativen Auffälligkeiten lassen sich benennen <strong>und</strong> bei<br />
Bedarf diskutieren. Mit diesem gesteuerten Feedback können zwar viele ltems evaluiert<br />
werden, die Reichhaltigkeit derWahrnehmungen ist dagegen eingeschränkt. Ein kriterienorientiertes<br />
Feedback kann bei Bedarf am Ende der St<strong>und</strong>en als Kurzrückmeldung in<br />
wenigen Minuten eingeholt werden.<br />
ln interaktiv-prozessorientierten Feedbackformen (Landwehr, 2003) wird der Austausch<br />
über Wahrnehmungen ausdrücklich gewünscht. Nachdem jeder sein individuelles<br />
Feedback notiert hat, diskutieren mehrere Feedbackgeber über ihre Meinungen,<br />
verifizieren evtl. die eigenen Rückmeldungen <strong>und</strong> bilden sich so ein reflektiertes Urteil.<br />
,,stimmenfang" (s.S. 108) <strong>und</strong> ,,Cruppenarbeit bilanzieren" (s.S. 99) entsprechen diesem<br />
Ansatz.<br />
Bei kooperativen Lernarrangements sollte neben dem Ergebnis auch der Arbeitsprozess<br />
evaluiert werden, <strong>und</strong> zwar zunehmend durch die Lernenden selbst. Unserer<br />
Erfahrung nach sind Schüler durchaus in der Lage, ihre Leistung <strong>und</strong> ihr Verhalten selbst<br />
einzuschätzen. Als Korrektiv wirken zudem die anderen Cruppenmitglieder, da sie besser<br />
als ein Beobachter von außen das Engagement jedes einzelnen beurteilen können.<br />
Kontinuierlich ausgefüllte Beobachtungsbögen unterstützen die Evaluation. Die Lernenden<br />
sollen das Feedback der anderen als Lernhilfe annehmen. Ziel ist, die eigene<br />
Handlung zu optimieren <strong>und</strong> damit Verantwortung für ein gutes Cruppenergebnis zu<br />
übernehmen. Alle Beteiligten werden so aktiv in den Cruppenprozess mit einbezogen<br />
<strong>und</strong> übernehmen Mitverantwortung für ihr Lernen.<br />
Die Rückmeldungen der Schüler sind immer subjektiv geprägt. Sie melden an den<br />
Feedbackempfänger (Lehrer oder Schüler) ihre persönlichen Empfindungen zurück, ,, ...<br />
ohne Anspruch auf einen objektiven Wahrheitsgehalt" (Landwehr, 2003, S.9). Hintergr<strong>und</strong><br />
ist aus konstruktivistischer Sicht, dass Erfahrungen <strong>und</strong> Empfindungen immer<br />
individuell verarbeitet werden <strong>und</strong> nicht automatisch allgemeingültige Rückschlüsse<br />
gezogen werden können. Landwehr schreibt von der ,,doppelten Subjektivität" im Feedbackprozess.<br />
Die Feedbackgeber teilen ihre subjektive Meinung autonomen Feedback-