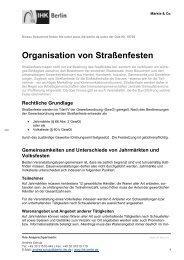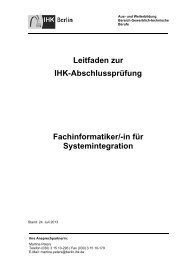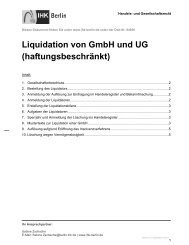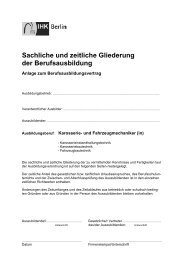Juni 2013 - IHK Berlin
Juni 2013 - IHK Berlin
Juni 2013 - IHK Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SERVICE<br />
RECHT<br />
GbR auch<br />
ohne eigenes<br />
Kapital<br />
Die Beteiligung an einer Gesellschaft<br />
bürgerlichen<br />
Rechts (GbR) setzt nicht voraus,<br />
dass jeder Gesellschafter<br />
sich mit einem Kapitalanteil<br />
beteiligt. Dies wurde<br />
vom OLG Frankfurt (Beschl.<br />
v. 20.09.2012, Az. 20 W 264/12)<br />
bestätigt. Das Wesen der GbR,<br />
der Zusammenschluss der<br />
Gesellschafter zur Erreichung<br />
eines gemeinsamen Zweckes<br />
nach § 705 BGB, bedeutet<br />
nicht, dass jeder Gesellschafter<br />
Kapital einbringen muss.<br />
Der Unterstützungsbeitrag<br />
kann auch in der Leistung von<br />
Diensten liegen.<br />
Der Entscheidung lag der<br />
Antrag auf Eintragung einer<br />
GbR als Eigentümerin eines<br />
Grundstücks im Grundbuch<br />
zugrunde. Das Grundstück<br />
wurde im Rahmen der GbR-<br />
Gründung durch einen Gesellschafter<br />
in die Gesellschaft<br />
eingebracht. Im Gesellschaftsvertrag<br />
war vereinbart, dass<br />
die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens<br />
durch den<br />
Gesellschafter ohne Kapitalanteil<br />
mit übernommen wird<br />
und seine Arbeitsleistungen<br />
als Beiträge gelten. Der Gesellschaft<br />
wurde vom Grundbuchamt<br />
die Existenz abgesprochen,<br />
weil ein Gesellschafter<br />
alle Kapitalanteile halte.<br />
Das OLG gab der GbR Recht.<br />
Wie die Förderbeiträge im<br />
Sinne einer prozentualen Beteiligung<br />
an der GbR gewertet<br />
werden, sei Sache der Gesellschafter.<br />
Der von einem Gesellschafter<br />
eingebrachte Kapitalanteil<br />
in Form des Grundstückes<br />
sei jedenfalls nicht<br />
automatisch mit dem Anteil<br />
an der Gesellschaft als solcher<br />
gleichzusetzen.<br />
zs<br />
Der Bundesgerichtshof bekräftigte seine Rechtsprechung: Vermieter müssen gewerblichen Musikunterricht nicht dulden<br />
Rechtmäßig gekündigt<br />
BGH: Gewerbe in Mietwohnung bei Belästigung anderer Mieter unzulässig<br />
In einer aktuellen Entscheidung<br />
beschäftigte sich der<br />
Bundesgerichtshof (BGH) mit<br />
der Frage, ob der Vermieter die<br />
Nutzung einer Mietwohnung<br />
zum Zwecke gewerblichen<br />
Musikunterrichts dulden muss<br />
(BGH, Urteil vom 10.04.<strong>2013</strong>,<br />
VIII ZR 213/12).<br />
Ein Mieter hatte in der Wohnung<br />
an drei Werktagen Gitarrenunterricht<br />
für etwa 12 Schüler<br />
erteilt. Wegen des Lärms<br />
kam es mit den anderen Mietern<br />
zu Streitigkeiten. Der Vermieter<br />
kündigte daraufhin das<br />
Mietverhältnis außerordentlich.<br />
Im Ergebnis erklärte der<br />
BGH die Kündigung für rechtmäßig.<br />
Der BGH bekräftigte damit<br />
seine Rechtsprechung, wonach<br />
bei geschäftlichen Aktivitäten<br />
freiberuflicher oder<br />
gewerblicher Art, die nach außen<br />
in Erscheinung treten, eine<br />
Nutzung vorliegt, die der<br />
Vermieter in ausschließlich zu<br />
Wohnzwecken angemieteten<br />
Räumen ohne entsprechende<br />
Vereinbarung grundsätzlich<br />
nicht dulden muss. Das heißt<br />
jedoch nicht, dass zu Wohnzwecken<br />
angemietete Räume<br />
grundsätzlich nicht gewerblich<br />
genutzt werden dürfen. Der<br />
Vermieter kann das Mietverhältnis<br />
nur dann außerordentlich<br />
kündigen, wenn durch die<br />
gewerbliche Nutzung die anderen<br />
Mieter mehr belästigt<br />
werden als durch die übliche<br />
Wohnnutzung. Unproblematisch<br />
erlaubt sind Nutzungen<br />
für normale Büroarbeiten, es<br />
sei denn, der Mietvertrag sieht<br />
strengere Regelungen ausdrücklich<br />
vor. Nie erlaubt in<br />
angemietetem Wohnraum sind<br />
etwa der Betrieb freiberuflicher<br />
Praxen oder Geschäfte mit<br />
Laufkundschaft. Fatih Biskin/loh<br />
Kündigung und Treu und Glauben<br />
Bewegt ein Arbeitgeber einen<br />
Arbeitnehmer mit einer Gehaltserhöhung<br />
zur Fortsetzung<br />
des Arbeitsverhältnisses, verhindert<br />
das nicht eine fünf Monate<br />
später ausgesprochene<br />
betriebsbedingte Kündigung.<br />
Das hat das Landesarbeitsgericht<br />
Köln im Fall eines Arbeitnehmers<br />
in einem Kleinbetrieb<br />
entschieden, bei dem<br />
Paragraf 1 Kündigungsschutzgesetz<br />
keine Anwendung fand<br />
(vom 28. September 2012; Az.:<br />
4 Sa 569/12). Der Arbeitgeber<br />
hatte den Arbeitnehmer wenige<br />
Monate vor der Kündigung<br />
durch eine Gehaltserhöhung<br />
davon abgehalten, die Firma<br />
zu wechseln. Als der Arbeitgeber<br />
die betriebsbedingte Kündigung<br />
aussprach, machte der<br />
Arbeitnehmer geltend, dass<br />
dieses Verhalten gegen Treu<br />
und Glauben verstoße. Das<br />
Gericht weist darauf hin, dass<br />
die diesen Grundsatz regelnde<br />
Vorschrift (vgl. Paragraf 242<br />
BGB) auf Kündigungen neben<br />
dem Kündigungsschutzgesetz<br />
nur in beschränktem Umfang<br />
anwendbar sei, weil das Kündigungsschutzgesetz<br />
den Bestandsschutz<br />
und die Arbeitnehmerinteressen<br />
abschließend<br />
regele.<br />
bs<br />
FOTO: PA/ROBERT B. FIS<br />
40 I <strong>Berlin</strong>er Wirtschaft 06-13