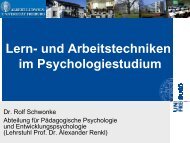Tremor-Untersuchunge.. - Jochen Fahrenberg
Tremor-Untersuchunge.. - Jochen Fahrenberg
Tremor-Untersuchunge.. - Jochen Fahrenberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 72 -<br />
begrenzt. Es wurde eine Kategorial-Variable<br />
Sitzen eingeführt mit den Werten<br />
1=sitzen und 0=stehen (= nicht sitzen).<br />
• Die Lage der Hand, an der <strong>Tremor</strong> gemessen<br />
wurde.<br />
Dies wurde aufgrund einer Reviewer-<br />
Nachfrage bei Foerster und <strong>Fahrenberg</strong><br />
(2000) untersucht. Die DC-Werte der<br />
Hand-Sensoren liegen bei waagrechtem<br />
Handrücken (wie z.B. beim Halte-<br />
<strong>Tremor</strong>) etwa bei 1 g, bei herabhängender<br />
Hand bei 0 g. 4<br />
• Die Herzfrequenz mit abgeleiteten Größen.<br />
Die Herzfrequenz als zentrale Größe<br />
bzw. Korrelat der körperlichen und geistigen<br />
Aktivierung wurde bereits in den<br />
Basis-Tabellen 15 bis 18 mit aufgeführt.<br />
Für die Verlaufs-Analysen wurden zwei<br />
weitere von der Herzfrequenz abgeleitete<br />
Variable verwendet, zum einen die<br />
„additional heart rate“, d.h. die nichtmetabolische<br />
Herzfrequenz-Erhöhung,<br />
die nach Myrtek et al. (1988) als Maß<br />
für die emotionale Beanspruchung angesehen<br />
werden kann, zum zweiten die<br />
Variation der Herzfrequenz von Schlag<br />
zu Schlag, gemessen als die Wurzel<br />
aus dem mittleren Quadrat sukzessiver<br />
Differenzen MQSD, die z.B. nach Rohmert<br />
& Rutenfranz (1975) mit der mentalen<br />
Beanspruchung zusammenhängt<br />
(mentale Beanspruchung führt zu abnehmender<br />
Variabilität der Herzfrequenz).<br />
5<br />
Da der Algorithmus zur Bestimmung der<br />
„additional heart rate“ (EMO) von Minuten-<br />
Segmenten ausgeht, wurden die Verlaufs-<br />
Analysen (anders als alle bisherigen Analysen,<br />
die auf Fünf-Minuten-Segmenten<br />
basieren) an Minuten-Segmenten durchgeführt<br />
(kleine Unterschiede bei Korrelationen,<br />
z.B. Tabelle 21). Wegen der Abhängigkeit<br />
der Messungen bei Zeitreihenanalysen<br />
und der großen Anzahl der Daten-<br />
4 Die DC-Werte der Hände in der Laborphase Ruhetremor<br />
betrug rechts=0.71, links=0.75; beim Haltetremor<br />
rechts=0.90, links=0.90; beim Stehen<br />
rechts=0.20, links=0.27.<br />
5 Bei der Verwendung des MQSD als Maß der mentalen<br />
Belastung muß allerdings auf die inkonsistente<br />
Befundlage hingewiesen werden (u.a. aufgrund nicht<br />
kontrollierter Atmung). Überhaupt sind die Konzepte<br />
„emotionale“ und „mentale“ Beanspruchung bzw. die<br />
Dekomposition der Varianzen heuristisch gemeint.<br />
Die Differenzierungen sind nur unter mehreren Vorbehalten<br />
möglich.<br />
punkte sind alle Signifikanz-Tests nur als<br />
Vergleichs-Zahlen, allenfalls als Anhaltspunkt<br />
für weitere Analysen, zu werten.<br />
Zunächst wurden die fünf Prädiktoren<br />
emotionale Beanspruchung, mentale Beanspruchung,<br />
Handhaltung, Herzfrequenz<br />
und Körperlage für jeden Patienten getrennt<br />
mit den beiden Kriterien <strong>Tremor</strong>-<br />
Häufigkeit und <strong>Tremor</strong>-Amplitude korreliert.<br />
Beurteilt wurden die Korrelations-Koeffizienten<br />
nach ihrem Beitrag zur Varianz-Aufklärung<br />
bei der multiplen Regression.<br />
Tabelle 22 zeigt zwar eine große Anzahl<br />
signifikanter Befunde, doch sind die verwendeten<br />
statistischen Tests fraglich, da<br />
die Beobachtungen (Minuten) nicht unabhängig<br />
sind. Auch sind die Ergebnisse sogar<br />
in der Richtung (Vorzeichen der Korrelationen)<br />
uneinheitlich. So „ wirkt“ die „emotionale<br />
Beanspruchung“ in 8 Fällen (Patienten,<br />
Termine) abschwächend auf die<br />
<strong>Tremor</strong>-Häufigkeit, in 3 bzw. 4 Fällen verstärkend<br />
auf die <strong>Tremor</strong>-Häufigkeit, bzw.<br />
Amplitude. Ähnlich die „mentale Beanspruchung“,<br />
die 6 bzw. 3 mal negativ (im Sinne<br />
der Hypothese) und 1 bzw. 4 mal positiv<br />
(entgegen der Hypothese) mit Häufigkeit<br />
bzw. Amplitude korreliert. Die Handhaltung<br />
hat wohl keinen Einfluß auf die Amplitude<br />
(6 positive, 5 negative Korrelationen), vielleicht<br />
jedoch auf die Häufigkeit: in 10 Fällen<br />
war der <strong>Tremor</strong> häufiger, je waagrechter<br />
die Hand gehalten wird. Die Herzfrequenz<br />
korreliert meist positiv mit beiden <strong>Tremor</strong>-<br />
Variablen, mit der Amplitude sogar .25 in<br />
der gepoolten P-Matrix. Der Einfluß von<br />
Sitzen ist für Häufigkeit und Amplitude unterschiedlich:<br />
im Sitzen hatten die Patienten<br />
eher mehr <strong>Tremor</strong>, jedoch mit geringerer<br />
Amplitude. Dies geht vermutlich auf die<br />
bereits beschriebene Korrelation der<br />
Handhaltung zurück: beim Sitzen sind die<br />
Hände eher waagrecht, beim Stehen hängen<br />
sie eher herab. In diesem Zusammenhang<br />
muß allerdings auf die komplexen<br />
Wechselwirkungen und Konfundierungen<br />
der möglichen Einflußgrößen aus dem Bereich<br />
Tätigkeiten-Körperlage-Hanhaltung<br />
hingewiesen werden.<br />
Um den Einfluss der „emotionalen Beanspruchung“<br />
auf die <strong>Tremor</strong>aktivität zu belegen,<br />
wurden außerdem Zeitverschiebungen<br />
(Lags) und Filter (gleitende Mittelwerte)<br />
versucht. Die Ergebnisse entsprachen<br />
denen der Tabelle 22, Erhöhung der<br />
Korrelationen wurden nicht gefunden.