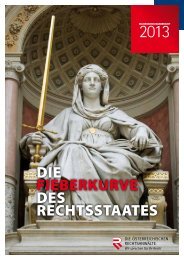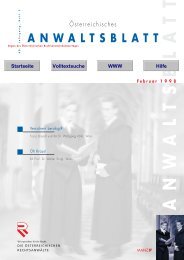AnwBl_2013-06_Umschlag 1..4 - Österreichischer ...
AnwBl_2013-06_Umschlag 1..4 - Österreichischer ...
AnwBl_2013-06_Umschlag 1..4 - Österreichischer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht<br />
ten, weil schon durch die Unternehmereigenschaft des<br />
Veräußerers ein geschäftlicher Kontext garantiert ist.<br />
b) Bereitstellung digitaler Inhalte<br />
Überraschenderweise nicht als „Kauf“ bezeichnet wird<br />
der Vertrag über die Bereitstellung digitaler Inhalte.<br />
Diese werden in Art 5 lit b – also an anderer Stelle als<br />
der Kaufvertrag – definiert als „Verträge über die Bereitstellung<br />
digitaler Inhalte, gleich, ob auf einem materiellen<br />
Datenträger oder nicht, die der Nutzer speichern,<br />
verarbeiten oder wiederverwenden kann oder<br />
zu denen er Zugang erhält, unabhängig davon, ob die<br />
Bereitstellung gegen Zahlung eines Preises erfolgt oder<br />
nicht“. Die deutsche Übersetzung des Entwurfs weicht<br />
hier allerdings von der – von den Verfassern ursprünglich<br />
verwendeten – englischen Sprachfassung in durchaus<br />
signifikanter Weise ab. Dort ist von „(. . .) which can<br />
be stored, processed or accessed, and re-used by the user (. . .)“<br />
die Rede. Der Unterschied liegt darin, dass der bloße<br />
Zugang in der deutschen Fassung als gleichberechtigte<br />
Alternative zu Speicherung, Verarbeitung oder Wiederverwendung<br />
genannt wird, während in der englischen<br />
Fassung der Zugang eine Alternative zur Verarbeitung<br />
ist und unabhängig davon (und zwar kumulativ)<br />
die Voraussetzungen der Speicherung und Wiederverwendung<br />
genannt sind. Diese scheinbar haarspalterische<br />
Differenzierung hat weit reichende Konsequenzen,<br />
6) weil nach der deutschen Fassung bspw einmaliges<br />
Streaming ebenso erfasst wäre wie die Zugänglichmachung<br />
von Software in einer Cloud („Software as a Service“),<br />
ja möglicherweise sogar der Vertrag zwischen<br />
dem Nutzer und dem Betreiber einer Online-Plattform<br />
oder dem Besucher und dem Bereitsteller einer Website,<br />
da auch dabei jeweils digitale Inhalte „zugänglich<br />
gemacht“ werden. Dazu will es allerdings nicht passen,<br />
dass in Anh I die Bereitstellung digitaler Inhalte im<br />
Wesentlichen dem Warenkauf gleichgestellt wird, ja<br />
für den besonders bedeutsamen Teil IV über die<br />
Rechte und Pflichten der Parteien sogar terminologisch<br />
von „Verkäufer“ und „Käufer“ die Rede ist (vgl Art 91<br />
des Anhangs I). Das alles spricht dafür, dass nur solche<br />
Verträge über digitale Inhalte erfasst sein sollten, die<br />
ihrem Wesen nach kaufähnlich sind, insb bei denen<br />
die digitalen Inhalte dergestalt in den Machtbereich<br />
des Kunden gelangen, dass dieser eine zeitlich wie inhaltlich<br />
prinzipiell unbeschränkte Nutzungsmöglichkeit<br />
erhält. 7) Für diese Deutung spricht es auch, dass<br />
der Entwurf des Rechtsausschusses des Europäischen<br />
Parlaments gerade im Hinblick auf eine gewünschte<br />
Erweiterung des Instruments auf Fälle des Cloud Computing<br />
ausdrücklich „storage“ als verbundene Dienstleistung<br />
erwähnt (Änderung 41).<br />
Durchaus überraschend ist es allerdings nicht nur,<br />
dass diese Verträge nicht als „Kauf“ bezeichnet werden,<br />
sondern auch, dass sich die zur Nutzung digitaler Inhalte<br />
erforderliche Lizenz im ganzen Instrument mit keinem<br />
Wort erwähnt findet. Während in der Definition des<br />
Warenkaufs allein auf die rechtliche Komponente<br />
(Übertragung des Eigentums) abgestellt wird und sich<br />
die faktische Komponente (Lieferung) erst aus den Verkäuferpflichten<br />
in Kapitel IV des Anh I findet, wird hinsichtlich<br />
digitaler Inhalte allein auf die faktische Komponente<br />
(Bereitstellung) abgestellt, während sich die<br />
rechtliche (Einräumung oder Übertragung einer entsprechenden<br />
Lizenz) nur in Art 91 lit d des Anhangs angedeutet<br />
findet als Verpflichtung des Unternehmers,<br />
„sicherzustellen, dass der Käufer das Recht hat, die digitalen<br />
Inhalte entsprechend dem Vertrag zu nutzen“.<br />
Richtigerweise sollten beide Verträge als „Kauf“ bezeichnet<br />
und konstruiert werden. Dafür spricht im Übrigen<br />
auch die E des Gerichtshofs v 3. 7. 2012 in der<br />
Rechtssache UsedSoft, 8) wo nicht nur die mit einer zeitlich<br />
unbefristeten Lizenz verbundene Bereitstellung<br />
von Software als Kauf qualifiziert, sondern sogar das<br />
Recht des Nutzers als „Eigentum“ an der Programmkopie<br />
bezeichnet wurde. 9) Auf diese Weise würde auch<br />
die Terminologie des gesamten Instruments wesentlich<br />
vereinfacht.<br />
c) Verbundene Dienstleistungen<br />
Verbundene Dienstleistungen sind generell der dritte<br />
Vertragstyp, der vom CESL erfasst sein soll. Damit<br />
steht das Instrument im Dienstleistungsbereich nur<br />
zur Verfügung, wenn inhaltlich eine Verbindung zu einem<br />
Kaufvertrag bzw Vertrag über die Bereitstellung<br />
digitaler Inhalte gegeben ist, wie etwa im Fall von Installation,<br />
Reparatur oder Wartung der gekauften Sache.<br />
Ferner ist erforderlich, dass die Dienstleistungserbringung<br />
entweder im Kaufvertrag selbst oder aber aufgrund<br />
eines gesonderten Dienstleistungsvertrags mit<br />
dem Verkäufer vereinbart wird. Nicht möglich ist es<br />
damit, hinsichtlich der Dienstleistung mit einem anderen<br />
Unternehmer als dem Verkäufer zu kontrahieren.<br />
Zugleich verlangt Art 2 lit m, dass ein gesonderter<br />
Dienstleistungsvertrag zeitgleich mit dem Kaufvertrag<br />
abgeschlossen wird, wobei der Sinn dieser letzten Einschränkung<br />
im Dunklen bleibt und außerdem Art 42<br />
Abs 1 lit e des Anh I das Gegenteil suggeriert. Anzumerken<br />
bleibt, dass ein gesonderter Preis für die<br />
Dienstleistung nicht vereinbart werden muss.<br />
6) So zuerst zutreffend Zoll, Das Dienstleistungsrecht, in Schulte-<br />
Nölke/Zoll/Jansen/Schulze (Hrsg), Optionales europäisches Kaufrecht<br />
(2012) 285 f.<br />
7) Wendehorst in Schulze (Hrsg), Common European Sales Law (2012)<br />
Regulation Article 5 Rz 19 ff.<br />
8) Gerichtshof der Europäischen Union, C-128/11 (2012).<br />
9) Vgl aaO Rz 44 ff: „Dadurch, dass Oracle eine Kopie des Computerprogramms<br />
zugänglich macht und ein entsprechender Lizenzvertrag<br />
abgeschlossen wird, soll diese Kopie für die Kunden (. . .) dauerhaft<br />
nutzbar gemacht werden. Unter diesen Umständen wird (. . .) das Eigentum<br />
an der Kopie des betreffenden Computerprogramms übertragen.“<br />
346<br />
Der Anwendungsbereich des Gemeinsamen Europäischen Kaufrechts<br />
Autorin: Univ.-Prof. Dr. Christiane Wendehorst, LL. M. (Cambridge), Wien<br />
Österreichisches Anwaltsblatt <strong>2013</strong>/<strong>06</strong>