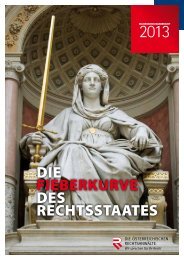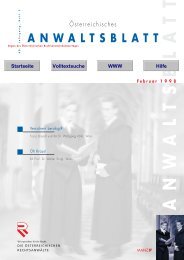AnwBl_2013-06_Umschlag 1..4 - Österreichischer ...
AnwBl_2013-06_Umschlag 1..4 - Österreichischer ...
AnwBl_2013-06_Umschlag 1..4 - Österreichischer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abhandlung<br />
tigen Zivilverfahren und nach der StPO kein Anwendungsbereich.<br />
19)<br />
§ 1 Abs 2 Satz 1 RATG 1969 für Zivilverfahren einerseits<br />
und Strafverfahren andererseits unterschiedlich<br />
auszulegen, kommt mE nicht in Betracht. Entweder<br />
ist also eine der beiden Rechtsprechungslinien (im<br />
Ergebnis oder in der Begründung) unrichtig oder § 1<br />
Abs 2 Satz 1 RATG 1969 ist auf Strafverfahren, auch<br />
wenn es sich um eine Privatanklage oder -beteiligung<br />
handelt, nicht anwendbar. Aufschluss über den Gehalt<br />
und die Reichweite des heutigen § 1 Abs 2 Satz 1<br />
RATG 1969 sowie sein Verhältnis zu den Kostenersatzbestimmungen<br />
der verschiedenen Verfahrensordnungen<br />
bietet seine Entstehungsgeschichte.<br />
2. Genese des § 1 Abs 2 RATG 1969<br />
Die Wurzeln des heutigen § 1 Abs 2 Satz 1 RATG liegen<br />
in der Tarifverordnung 1897, 20) die auf Basis des<br />
Advocatentarif-Gesetzes 1890 21) erging. Sie enthielt in<br />
§ 17 leg cit unter der Überschrift „Entlohnung des Advocaten<br />
in eigener Rechtssache“ folgende Anordnung:<br />
„Ein Advocat kann in seiner eigenen Rechtssache die einem<br />
bevollmächtigten Advocaten zukommenden Gebüren<br />
von der kostenersatzpflichtigen Gegenpartei beanspruchen.“<br />
Damit kam deutlich zum Ausdruck, dass es sich um<br />
eine selbständige – freilich nur im Verordnungsrang<br />
stehende 22) – Kostenersatzregel handelte: Der Rechtsanwalt<br />
in eigener Sache war im Ergebnis wie ein „bevollmächtigter<br />
Advocat“ zu behandeln (vgl auch § 7<br />
dRAGebO 1879; 23) später § 91 Abs 2 Satz 3 bzw 4<br />
dZPO). 24) In ihrer Stammfassung war diese Bestimmung<br />
wohl nur auf Zivilrechtssachen anwendbar; 25)<br />
die Tarifverordnung 1897 nimmt auf „streitige“, „Executions-(Sicherungs-)“,<br />
„außerstreitige“ (§§ 5, 8, 19 leg<br />
cit) sowie „schiedsgerichtliche“ (§ 20 leg cit) Verfahren,<br />
nicht aber auf Strafverfahren Bezug.<br />
Der Rechtssatz des § 17 Tarifverordnung 1897<br />
wurde mit der Tarifverordnung 1909 26) und schließlich<br />
mit der Vollzugsanweisung 1920 27) im Kern unverändert<br />
fortgeschrieben (in Folge: Tarifverordnung<br />
1909/1920); 1909 kam es bloß zu orthografischen Anpassungen,<br />
1920 hat man den Ausdruck „Advokat“<br />
durch „Rechtsanwalt“ ersetzt. Seit 1909 fanden „die<br />
Tarifposten“ jedoch auch auf „Leistungen im Strafverfahren“<br />
Anwendung (§ 1 Abs 2 Tarifverordnung 1909/<br />
1920). Unsicherheit herrschte darüber, ob damit § 17<br />
Tarifverordnung 1909/1920 auf Strafverfahren erstreckt<br />
worden war. Anders als etwa Klar 28) ging jedenfalls<br />
der OGH davon aus, dass § 17 leg cit „nur Zivilrechtssachen<br />
(. . .) im Auge hat“. 29)<br />
Gewissheit brachte diesbezüglich das RATG 1923, 30)<br />
mit dem das Tarifrecht auf eine neue Rechtsgrundlage<br />
gestellt wurde; sein § 4 Abs 2 lautete wie folgt:<br />
„In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gebührt dem Rechtsanwalte<br />
die tarifmäßige Entlohnung auch dann, wenn ihm<br />
in seiner eigenen Rechtssache Kosten vom Gegner zu ersetzen<br />
sind.“<br />
Damit hat man den Rechtssatz aus § 17 Tarifverordnung<br />
1897/1909/1920 übernommen; seine Begrenzung<br />
auf bürgerliche Rechtssachen stand nunmehr außer<br />
Streit. Neben dieser Klarstellung wurde die Kostenersatzregel<br />
aber auch gezielt in den Gesetzesrang gehoben.<br />
Die dahinterstehende Absicht des Gesetzgebers<br />
lässt sich anhand der Materialien zweifelsfrei feststellen:<br />
31) „Die Vorschrift des § 4, Abs 2, wonach der<br />
Rechtsanwalt in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten den<br />
Ersatz der Anwaltskosten auch dann verlangen kann,<br />
wenn er seine eigene Sache führt, gilt schon seit einem<br />
Vierteljahrhundert. Sie stand bisher in § 17 der Tarifverordnung.<br />
Da es aber immerhin zweifelhaft sein<br />
kann, ob es sich dabei um eine reine Tarifvorschrift<br />
und nicht um eine Abweichung von dem Grundsatze<br />
19) Kritisch daher Kornfeld, MR 1992, 17 („führt . . . kerzengerade ins<br />
Nichts“); anders Schmidt, ÖBl 1993, 7.<br />
20) Verordnung des Justizministers, durch welche auf Grund des Gesetzes<br />
v 26. 3. 1890 (RGBl 1890/58) für die Entlohnung der in diesem<br />
Gesetze bezeichneten Leistungen der Advocaten und ihrer Kanzleien<br />
ein Tarif erlassen wird, RGBl 1897/293. Die erste Tarifverordnung<br />
1890 (RGBl 1890/129) und jene Verordnungen, mit denen sie modifiziert<br />
bzw ihr räumlicher Anwendungsbereich erweitert wurde (RGBl<br />
1891/116, 1892/59, 1892/82), enthielten noch keine Bestimmung<br />
über den Rechtsanwalt in eigener Sache; vgl Klar, GZ 1928, 369.<br />
21) Gesetz, wodurch der Justizminister ermächtigt wird, bezüglich solcher<br />
Leistungen der Advocaten und ihrer Kanzleien im gerichtlichen<br />
Verfahren, welche wegen ihrer Einfachheit und Wiederkehr eine<br />
durchschnittliche Bewertung zulassen, einen Tarif im Verordnungswege<br />
zu erlassen, RGBl 1890/58.<br />
22) Zweifel an einer hinreichenden Rechtsgrundlage lässt Klar (GZ 1928,<br />
369) erkennen; zum Problem der Verdrängung des im Gesetzesrang<br />
stehenden Kostenersatzrechts durch eine Bestimmung im Verordnungsrang<br />
s bei FN 32.<br />
23) § 7 Gebührenordnung für Rechtsanwälte (dRGBl 1879, 176): „Bei<br />
dem Betrieb eigener Angelegenheiten kann der Rechtsanwalt von<br />
dem zur Erstattung der Kosten des Verfahrens verpflichteten Gegner<br />
Gebühren und Auslagen bis zu dem Betrage fordern, in welchem er<br />
Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet<br />
verlangen könnte.“<br />
24) § 91 Abs 2 Satz 4 dZPO idF dBGBl I 1957, 861, später § 91 Abs 2<br />
Satz 3 dZPO idF dBGBl I 2004, 718: „In eigener Sache sind dem<br />
Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren<br />
und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet<br />
verlangen könnte.“<br />
25) Die Verhandlungen über einen Tarif wurden schon lange vor 1890<br />
geführt; vgl StenProtHH 47. Sitzung der 4. Session (4. 6. 1868)<br />
1929 (Hervorhebung hinzugefügt): „Bei dem Abgange eines Uebereinkommens<br />
soll in Civilstreitigkeiten das Maß der Entlohnung für<br />
den Zeitaufwand und für die Mühewaltung des Advocaten, soweit<br />
es möglich ist, durch einen Tarif geregelt werden“; vgl auch ErläutRV<br />
537 BlgAH 10. Session 1, 3.<br />
26) Verordnung des Justizministers v 3. 6. 1909 über einen neuen Advokatentarif,<br />
RGBl 1909/82.<br />
27) Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz v 11. 3. 1920 über den<br />
Rechtsanwaltstarif, StGBl 1920/109.<br />
28) Klar, GZ 1928, 369.<br />
29) So das vom OGH zustimmend zitierte OLG Graz als Unterinstanz zu<br />
OGH 16. 11. 1911, Kr VI 164/11 KH 3.888.<br />
30) BG v 4. 6. 1923, betreffend den Rechtsanwaltstarif, BGBl 1923/305.<br />
31) ErläutRV 1429 BlgNR 1. GP 2.<br />
358<br />
Kostenersatzanspruch des Rechtsanwalts in eigener (Straf-)Sache<br />
Autor: Ass.-Prof. Dr. Andreas Geroldinger, Linz<br />
Österreichisches Anwaltsblatt <strong>2013</strong>/<strong>06</strong>