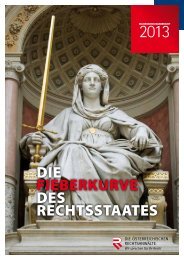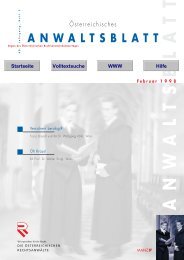AnwBl_2013-06_Umschlag 1..4 - Österreichischer ...
AnwBl_2013-06_Umschlag 1..4 - Österreichischer ...
AnwBl_2013-06_Umschlag 1..4 - Österreichischer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abhandlung<br />
des § 42 Z. P. O. handelt, wonach die Partei für ihre<br />
persönliche Bemühungen einen Kostenersatz nicht anzusprechen<br />
hat, erscheint es aus verfassungsrechtlichen<br />
Gründen vorsichtig, diese Vorschrift mit Gesetzeskraft<br />
auszustatten.“ § 4 Abs 2 RATG 1923 knüpfte also inhaltlich<br />
nahtlos an § 17 der Tarifverordnungen an<br />
und war als Modifikation des § 42 ZPO, als lex specialis,<br />
gedacht. Da die neue Bestimmung auf bürgerliche<br />
Rechtssachen beschränkt war, stellte sich die Frage<br />
nach ihrem Verhältnis zu §§ 380 ff StPO erst gar nicht.<br />
Das RATG 1969 32) erhob den Tarif in den Gesetzesrang<br />
und brachte einige inhaltliche Neuerungen. § 4<br />
Abs 2 RATG 1923 wurde in den § 1 Abs 2 vorverlagert<br />
und dort mit § 4 Abs 1 RATG 1923 verschmolzen. § 1<br />
RATG 1969 lautete, soweit hier von Interesse, wie folgt:<br />
„§ 1. (1) Die Rechtsanwälte haben im zivilgerichtlichen<br />
Verfahren und im schiedsrichterlichen Verfahren nach den<br />
§§ 577 ff der Zivilprozeßordnung sowie in Strafverfahren<br />
über eine Privatanklage und für die Vertretung von Privatbeteiligten<br />
Anspruch auf Entlohnung nach Maßgabe der folgenden<br />
Bestimmungen und des angeschlossenen, einen Bestandteil<br />
dieses Bundesgesetzes bildenden Tarifs.<br />
(2) Die Vorschriften dieses Bundesgesetzes gelten, soweit<br />
im folgenden nicht anderes bestimmt wird, sowohl im Verhältnis<br />
zwischen dem Rechtsanwalt und der von ihm vertretenen<br />
Partei als auch bei Bestimmung der Kosten, die der<br />
Gegner zu ersetzen hat, und zwar auch dann, wenn dem<br />
Rechtsanwalt in eigener Sache Kosten vom Gegner zu ersetzen<br />
sind. (. . .)“<br />
Die Ausführungen in den ErläutRV dazu sind denkbar<br />
knapp: 33) „[In § 1] werden § 2 Abs 1 und § 4 des Ermächtigungsgesetzes<br />
und § 1 der Verordnung zusammengefasst.<br />
Der Tarif soll, wie bisher, im Strafverfahren<br />
nur für das Privatanklageverfahren, im offiziösen<br />
Verfahren nur für die Vertretung des Privatbeteiligten<br />
gelten. Da sonstige Leistungen im Strafverfahren nicht<br />
nach dem Tarif zu entlohnen sind, ist nicht einzusehen,<br />
warum in solchen Fällen Reisekosten und Zeitversäumnis<br />
darnach zu vergüten sind, wie dies § 1 Abs 2 der<br />
Verordnung bestimmt; diese Bestimmung soll daher<br />
entfallen.“ Wenngleich die Materialien wenig Aufschluss<br />
über Einzelheiten des § 1 RATG 1969 geben,<br />
lassen sie die Absicht des Gesetzgebers, den Rechtssatz<br />
des § 4 Abs 2 RATG 1923 (und damit des § 17 Tarifverordnung<br />
1897/1909/1920) fortzuschreiben, doch<br />
deutlich erkennen. 34) Sie kommt weiters in der wörtlichen<br />
Übernahme der Wendung „auch dann, wenn<br />
[dem Rechtsanwalt] in eigener Sache Kosten vom Gegner<br />
zu ersetzen sind“ zum Ausdruck. Fraglich bleibt damit<br />
nur, ob dieser Rechtssatz fortan auch in bestimmten<br />
Strafverfahren Anwendung finden sollte.<br />
Die in § 4 Abs 2 RATG 1923 enthaltene Einschränkung<br />
„In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten“ ist jedenfalls<br />
entfallen; der Wortlaut des Gesetzes spricht daher<br />
für eine Erweiterung des Anwendungsbereichs. Ob es<br />
sich dabei um eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers<br />
handelte, lassen die Materialien nicht unmittelbar<br />
erkennen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang,<br />
dass die Begrenzung auf bürgerliche Rechtssachen<br />
durch das RATG 1923 eine Reaktion auf eine zuvor<br />
unklare Rechtslage war; dass diese Klarstellung<br />
etwas mehr als 40 Jahre später unabsichtlich gestrichen<br />
wurde, ist nicht ohne Weiteres zu unterstellen. Schließlich<br />
belegen die Materialien eindeutig, dass der Gesetzgeber<br />
den Anwendungsbereich des RATG 1969 in<br />
Strafverfahren hinterfragt hat, was auch zu dessen Anpassung<br />
führte. 35) Im Ergebnis ist mE daher nicht von<br />
einem Redaktionsversehen auszugehen. Wie noch zu<br />
zeigen ist, scheint eine Gleichbehandlung des Rechtsanwalts<br />
in eigener Sache vor den Zivil- und den Strafgerichten<br />
insb dort, wo es um den privatrechtlichen<br />
Anspruch geht (Privatbeteiligung), dringend geboten. 36)<br />
Auch die Strafgerichte erachten § 1 Abs 2 Satz 1<br />
RATG 1969 offenbar für im Strafverfahren anwendbar;<br />
sie legen der Bestimmung allerdings eine Bedeutung bei,<br />
die in ihrer Historie keine Deckung findet. 37) Dafür, dass<br />
der Gesetzgeber des RATG 1969 beabsichtigt hätte, § 4<br />
Abs 2 RATG 1923 – trotz weitgehender Übernahme des<br />
Wortlauts – einem (das Zivilverfahrensrecht erfassenden)<br />
völligen Bedeutungswandel zu unterziehen, ohne<br />
dies im Gesetzgebungsprozess mit nur einem Wort zu<br />
erwähnen, gibt es keine Anhaltspunkte.<br />
Damit erfasst § 1 Abs 2 Satz 1 RATG seit 1969 auch<br />
Verfahren über eine Privatanklage und Privatbeteiligung,<br />
38) womit dem Rechtsanwalt in eigener Sache<br />
Kostenersatz wie einem bevollmächtigten Anwalt gebührt.<br />
Der Rsp vor Inkrafttreten dieser legistischen<br />
Neuerung, mag sie auch richtig gewesen sein, kommt<br />
für die heutige Rechtslage kein entscheidendes Gewicht<br />
mehr zu. 39)<br />
3. Zur taxativen Aufzählung in § 381 StPO<br />
Auf Basis dieser Erkenntnis fällt auch das Argument,<br />
bei § 381 StPO handle es sich um eine taxative Aufzählung,<br />
als Stütze der strafgerichtlichen Rsp weg. Schließlich<br />
nehmen § 1 Abs 2 RATG 1969 und § 381 StPO im<br />
Stufenbau der Rechtsordnung denselben Rang ein.<br />
32) BG v 22. 5. 1969 über den Rechtsanwaltstarif, BGBl 1969/189.<br />
33) ErläutRV 1175 BlgNR 11. GP 11 f.<br />
34) Vgl auch OGH 9. 7. 1969, 7 Ob 109/69 SZ 42/111.<br />
35) Siehe bei FN 33.<br />
36) Siehe III.5.<br />
37) Siehe etwa OGH 29. 6. 2011, 15 Os 75, 76/11 k; vgl II. (drittes Argument).<br />
38) § 1 Abs 1 RATG 1969 erwähnt zwar die Subsidiaranklage (§ 72<br />
StPO) nicht. Angesichts ihrer sachlichen Nähe zur Privatbeteiligung<br />
und Privatanklage (vgl Korn/Zöchbauer in Fuchs/Ratz, WK-StPO [Loseblatt,<br />
Stand 2010] § 72 Rz 1 f mwN), die beide in § 1 Abs 1 RATG<br />
1969 angeführt sind, könnte die Anwendung von § 1 Abs 2 RATG<br />
1969 auch in diesem Fall erwogen werden (vgl aber OGH<br />
30. 8. 1989, 14 Os 100/89 SSt 60/53; Lendl in Fuchs/Ratz, WK-StPO<br />
§ 394 f Rz 25).<br />
39) Vgl auch Jahoda, <strong>AnwBl</strong> 1982, 194.<br />
Österreichisches Anwaltsblatt <strong>2013</strong>/<strong>06</strong><br />
Kostenersatzanspruch des Rechtsanwalts in eigener (Straf-)Sache<br />
Autor: Ass.-Prof. Dr. Andreas Geroldinger, Linz<br />
359