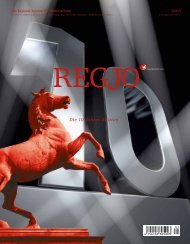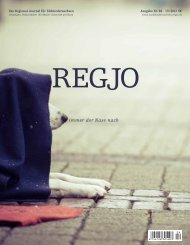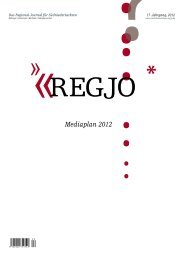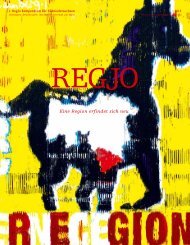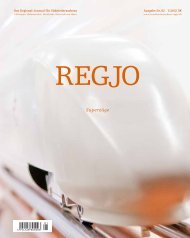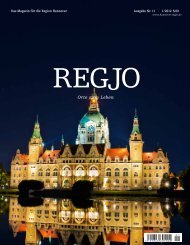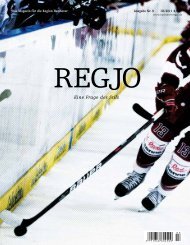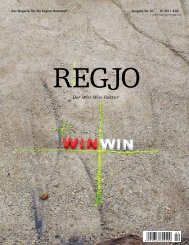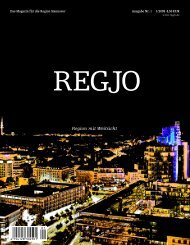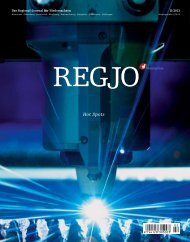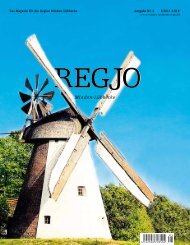22,2 MB - RegJo
22,2 MB - RegJo
22,2 MB - RegJo
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12 professorengespräch regjo südniedersachsen<br />
regjo südniedersachsen Professorengespräch 13<br />
„Das Sandwich gibt es nicht“<br />
Die Professoren Jürgen Dix und Florentin Wörgötter im 15. Professorengespräch über die Entwicklung Künstlicher<br />
Intelligenz, den nur schleppenden Fortschritt und den langen Weg zum belegten Brot à la Robot.<br />
Gesprächsleitung: Sven Grünewald Fotografie: Ronald Schmidt<br />
Welches Bild von Künstlicher Intelligenz wird uns gemeinhin<br />
vermittelt?<br />
Wörgötter: Dieses Medienbild wird durch Roboter geprägt, durch<br />
Maschinen, die die Weltherrschaft an sich reißen. Das prägt teilweise<br />
selbst die seriöse Berichterstattung. Die Maschinen werden<br />
menschenähnlich dargestellt – als ob sie mehr könnten als in Wirklichkeit<br />
der Fall ist. Das hat 1968 angefangen mit dem Film „2001:<br />
Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick mit dem berühmtem<br />
Computer HAL, der alles weiß und auf alles antworten kann. Heute,<br />
50 Jahre später, ist es immer noch extrem schwierig, natürliche<br />
Sprache maschinell zu verstehen.<br />
Dix: Ich könnte das Web zum Beispiel nicht fragen: Wie heißt dieses<br />
große Gebäude aus Eisen aus dem 19. Jahrhundert, das in Frankreich<br />
errichtet wurde? Wer darüber nachdenkt, würde sofort auf<br />
den Eiffelturm kommen. Das Web kann das nicht, weil dort nur<br />
ganz normale Zeichenreihen ohne Bedeutung stehen. Aber das<br />
semantische Web, das alles verknüpft und die Semantik hinter den<br />
Zeichen versteht, das wäre die Vision. Allerdings sind wir noch sehr<br />
weit davon entfernt.<br />
Wörgötter: Es ist inzwischen ein Problem, dass die Forschung so<br />
ausdifferenziert ist, dass jeder Teilbereich nur noch seine eigenen<br />
Konferenzen hat. Dabei gibt es natürlich viele interessante Ansätze,<br />
die sich über Kreuz befruchten könnten. Aber die Leute wissen<br />
nichts voneinander mit dem Ergebnis, dass eine Weiterentwicklung<br />
auch an fehlendem interdisziplinärem Austausch krankt.<br />
Dix: Man hat versucht, diese ganz unterschiedlichen Disziplinen<br />
vor ein paar Jahren bei der Grand Challenge zusammenzubringen.<br />
Dabei sollten autonome Fahrzeuge die Wüste durchqueren. Dafür<br />
braucht man alles: Mechanik; das Auto muss autonom fahren; Sie<br />
müssen die Gegend erkunden; Sie müssen Entscheidungen treffen;<br />
Sie müssen Bilder verstehen. Das sind Millionenprojekte – hinter<br />
jedem Fahrzeug stehen zweistellige Millionenbeträge, Arbeitsgruppen<br />
von 40 Leuten.<br />
Wörgötter: Der Eindruck von „Intelligenz“ ist heute bereits da.<br />
Wenn ich in Google einen Suchbegriff eingebe, dann wird der<br />
bereits nach den ersten zwei Worten ziemlich genau eingegrenzt.<br />
Das wirkt beeindruckend, hat aber mit menschenähnlichem Denken<br />
nichts zu tun. Große Konsortien, etwa Google, kommen<br />
allein durch den massiven Einsatz von Datensuch- und Datenbehandlungsalgorithmen<br />
so weit. Viele klassische KI-Probleme, das<br />
Schachspiel etwa, sind einfach durch wahnsinnig viel Rechenpower<br />
erschlagen worden.<br />
Dix: Ja, leider weniger durch Anwendung der KI. Das System<br />
erscheint nur intelligent. Beim Brettspiel Go ist man heute noch<br />
so weit entfernt wie vor 50 Jahren. Da ist die Komplexität viel zu<br />
groß, wohingegen heute schon normale Schachprogramme viele<br />
Großmeister schlagen können.<br />
Wie kommt man dann weiter in Richtung „echter“ KI?<br />
Wörgötter: Der notwendige interdisziplinäre Ansatz geschieht häufig<br />
leider nur auf Ebene einzelner Arbeitsgruppen. Nehmen wir<br />
die Robotik als Beispiel, die wirkt durchaus integrativ. Um einen<br />
humanoiden Roboter immer besser funktionieren zu lassen, ist man<br />
gezwungen, die verschiedenen Teilfelder tatsächlich zu nutzen und<br />
weiter voranzutreiben. Angefangen von der Mechanik über Kontrollalgorithmen,<br />
die Steuerung der Mechanik bis zur Sensorik mit<br />
Bilderkennung und haptischer Erkennung. Aber auch das klassische<br />
symbolische Verständnis von Objekten in der Welt ist wichtig,<br />
damit man dem Roboter Handlungsabläufe beibringen kann beziehungsweise<br />
die Maschine darüber nachdenkt und diese dann auch<br />
selbst durchführen kann. Bloß der Fluch bleibt, dass wir nicht oft<br />
genug mit Kollegen aus ganz anderen Fächern reden.<br />
Dix: Wer stand hinter der Grand Challenge? Die Darpa (Behörde<br />
zur Forschungsfinanzierung des amerikanischen Verteidigungsministeriums,<br />
Red.)! Und warum? Weil das Militär keinen Trend verpassen<br />
will. Für solche Entwicklungen braucht man Geld und zwar ziemlich<br />
viel. Autonomie hat große Vorteile. Stellen Sie sich ein eingestürztes<br />
Gebäude vor, Menschen müssen gerettet werden. Klassisch<br />
fahren Sie mit einer ferngesteuerten Maschine dort rein. Aber<br />
wir möchten natürlich Maschinen, die eigenständig handeln, die<br />
erkennen: Da liegt einer, bewegt sich aber nicht mehr. Ein anderer<br />
schreit noch, also wird zunächst der Bewusstlose untersucht. Dort<br />
kommen wir langsam auch tatsächlich hin.<br />
Wörgötter: Ein Beispiel ist der Marsrover – bei mindestens drei<br />
Minuten Laufzeit eines Signals vom Mars hin und zurück ist da<br />
nichts mit Fernsteuerung. So etwas wie Hindernisvermeidung können<br />
diese Maschinen heutzutage. Intelligenz im Sinne von Entscheidungsfähigkeit<br />
fehlt ihnen jedoch. Die Gefahr der Autonomie<br />
ist dabei, dass sie aus dem Ruder läuft. Wenn die Maschine nicht