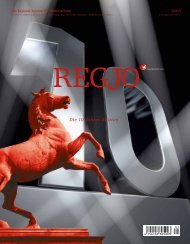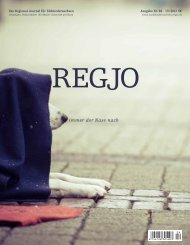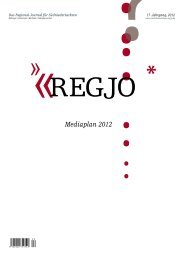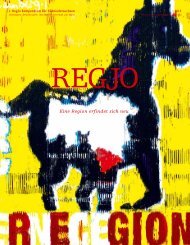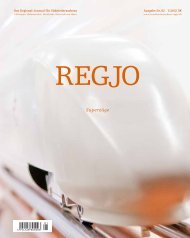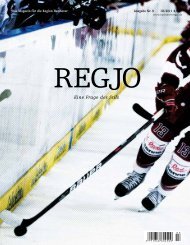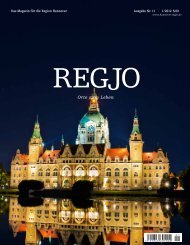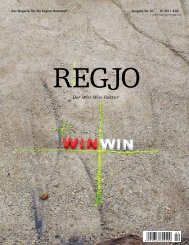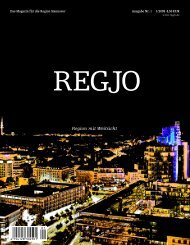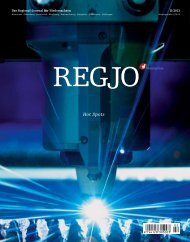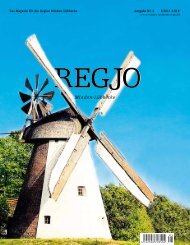22,2 MB - RegJo
22,2 MB - RegJo
22,2 MB - RegJo
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Regjo Südniedersachsen bildung spezial inklusion XXXIII<br />
Alltag: Werk-Unterricht mit förderbedürftigen und „normalen“ Schülern, betreut von zwei Lehrern, an der IGS in Göttingen.<br />
Im Fachunterricht Kunststoff stellen die Schüler ihre eigenen Klebebandabroller her. Einer der Schüler, Julian (Bild rechts), hat große Schwierigkeiten,<br />
sich zu konzentrieren. Ein studentischer Einzelfallhelfer (im Hintergrund) achtet permanent darauf, dass sich Julian weiter und wieder seiner<br />
Aufgabe widmet, statt abzuschweifen.<br />
dem jeweiligen Schulbezirk auf und die Förderpädagogen aus<br />
den Förderzentren werden dann in den Grundschulen eingesetzt,<br />
um mit den Grundschullehrkräften zusammen zu unterrichten.<br />
Die Fortbildungsangebote für Lehrer sind, laut Eberhard<br />
Brandt, Landesvorsitzender der Gewerkschaft für Erziehung und<br />
Wissenschaft (GEW) Niedersachsen, sehr stark nachgefragt: „Die<br />
Lehrer möchten wissen, wie man das Lernen mit beeinträchtigten<br />
Kindern plant und wie zusammen mit Förderschullehrkräften<br />
gemeinsamer Unterricht konzipiert wird. Es müssen allerdings<br />
mehr Fortbildungen angeboten werden als es bisher gibt.“ Auch<br />
Wolfgang Vogelsaenger, Leiter der IGS in Göttingen, schätzt den<br />
Bedarf an Fortbildungen für die Lehrer als sehr hoch ein, auch<br />
wenn für ihn ein Mentalitätswandel das Entscheidende ist: „Das<br />
Wichtigste ist eine andere Haltung als die, die der klassische Lehrer<br />
entwickelt hat: dass eben nicht das Fach im Mittelpunkt steht.“<br />
Um die Lehrkräfte zu unterstützen, hat das Kultusministerium<br />
Qualifizierungsangebote aufgelegt, mit denen Lehrer nach<br />
und nach weitergebildet werden. Grundschullehrer nutzen diese<br />
seit 2011, Lehrkräfte weiterführender Schulen nehmen seit Herbst<br />
2012 an den Fortbildungsmaßnahmen teil. 90 sogenannte „Teamer“<br />
wurden dafür ausgebildet. Die Teamer sind selbst Lehrkräfte<br />
des Primar-, Förderschul- und Sekundarbereichs, die in Zusammenarbeit<br />
mit der Universität Oldenburg für die Qualifizierung<br />
der Kollegen vorbereitet wurden. Als Zweierteams führen sie<br />
jeweils fünfeinhalbtägige Schulungen für bisher insgesamt über<br />
2.500 Lehrkräfte durch. Zum Vergleich: 2011 gab es in Niedersachsen<br />
rund 65.000 hauptberufliche Lehrkräfte. Die Schwerpunkte<br />
der Fortbildungen liegen in den Bereichen Unterrichtsgestaltung,<br />
Förderplanung und Diagnostik, Prävention und Intervention<br />
bei Verhaltensauffälligkeiten; der Umgang mit heterogenen<br />
Lerngruppen soll ebenso vermittelt werden wie die Erstellung von<br />
Handlungskonzepten bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen.<br />
Fortbildungen für die Lehrer müssen vor Ort, in den Schulen<br />
und im Unterricht selbst, stattfinden.<br />
Wichtig ist der Praxisbezug, Fortbildungen sind daher am effektivsten<br />
vor Ort, in den Schulen und mit den Schülern selbst.<br />
An der IGS geschieht das sozusagen „on the job“: „Unsere Förderschullehrer<br />
bilden unsere Fachlehrer mit aus, indem sie<br />
gemeinsam den Unterricht abhalten. Sie geben ihr Wissen<br />
an die Kollegen ganz automatisch weiter“, so Vogelsaenger.<br />
Die regionalen Fortbildungen sind in Niedersachsen an<br />
neun Kompetenzzentren delegiert. Im Raum Südniedersachsen<br />
wurde dafür etwa das Netzwerk Lehrerfortbildung<br />
(NLF) an der Georg-August-Universität Göttingen eingerichtet.<br />
Jedes Kompetenzzentrum ist für die Entwicklung, Organisation,<br />
Durchführung und Evaluation der von ihm angebotenen<br />
regionalen Fortbildung für öffentliche Schulen<br />
verantwortlich. Inhaltliche Schwerpunkte liegen - neben der<br />
Inklusion - in der Unterrichts- und Schulentwicklung, der Leseförderung,<br />
der Medienbildung und Deutsch als Zweitsprache.<br />
Einen Weiterbildungsmaster „Inklusive Pädagogik und Kommunikation“<br />
bietet seit Oktober 2012 die Universität Hildesheim an.<br />
Er ist berufsbegleitend studierbar und wird gut angenommen,<br />
berichtet Dr. Margitta Rudolph. Sie ist Direktorin des Weiterbildungszentrums<br />
der Uni Hildesheim und hat den Studiengang mit<br />
konzipiert. In der Regel sitzen in einem Semester 25 bis 30 Studierende<br />
aus Deutschland und der Schweiz. Auch die Studierendengruppen<br />
sind heterogen zusammengesetzt: von Erziehern, Lehrkräften<br />
aller Schulformen über Schulleiter und Sozialpädagogen.<br />
Fort- und Weiterbildungen sind wichtig, aber die Umsetzung inklusiven<br />
Unterrichts fängt schon in den Lehrplänen des Lehramtsstudiums<br />
an. Dabei haben selbst Universitäten, die Förderschullehrer<br />
ausbilden, einen gewissen Veränderungsbedarf. Der Umgang<br />
mit förderbedürftigen Kindern wird zwar gelehrt, das heißt aber<br />
nicht automatisch „inklusive“ Ausbildung. Denn in Zukunft müssen<br />
sie auch „normale“ Kinder mit berücksichtigen. „Die Fachlichkeit<br />
spielt bei den Sonderpädagogen eine ganz andere Rolle<br />
als beim Regelschullehrer. Das Verhältnis von Fachlichkeit und<br />
inklusivem Denken wird zur Debatte gestellt werden“, so Dr. Dirk<br />
Jahreis, Geschäftsführer des Netzwerks Lehrerfortbildung an der<br />
Uni Göttingen. „In der Ausbildung der Förderpädagogen muss sich<br />
in Zukunft außerdem widerspiegeln, dass sie nicht mehr nur für<br />
den Unterricht mit förderbedürftigen Kindern ausgebildet werden,<br />
sondern mehr und mehr als Experten. Sie werden als Berater<br />
tätig sein und das Unterrichten in den „Förderschulen“ ist nur<br />
noch ein Teil ihrer Arbeit.“ Auf der anderen Seite steht im Bereich<br />
der Ausbildung von Lehrkräften für allgemeinbildende Schulen<br />
aber immer noch die fachliche Ausbildung und weniger das Kind<br />
im Mittelpunkt. „Bereiche wie Pädagogik und Psychologie müssen<br />
zunehmend in die Ausbildung mit einbezogen werden“, so<br />
Prof. Gisela Schulze, Institutsdirektorin für Allgemeine Sonderpädagogik<br />
Rehabilitation an der Universität Oldenburg. In Oldenburg<br />
wird zum Beispiel das Wahlmodul „Hören, Lernen, Inklusion“<br />
angeboten, das für alle Lehramtsstudiengänge offen ist. Einzelne<br />
Angebote sind also vorhanden, allgemein aber haben Studenten,<br />
die nicht Sonderpädagogik studieren, kaum Zugang zu solchen<br />
Angeboten. „Wünschenswert an der Uni Göttingen wäre<br />
eine Professur mit der Professionalisierung Heterogenität. Denn<br />
auch, wenn hier keine Förderschullehrer ausgebildet werden, brauchen<br />
wir die Expertise dafür. Das läuft in der Hochschulstruktur<br />
über Professuren, was natürlich auch Geld kostet“, betont Prof.<br />
Hermann Veith, wissenschaftlicher Leiter des Netzwerks Lehrerfortbildung.<br />
„Inklusion als Sparmodell wird nicht funktionieren.<br />
Inklusion ist zeit- und finanzintensiv“, meint auch Gisela Schulze.<br />
Einen Ansatz für die Eingliederung von Inklusion in die Curricula<br />
zeigt das Nachbarland Bremen. Dort ist seit dem Wintersemester<br />
2011/2012 für alle Lehramtsstudenten eine Qualifizierung<br />
im Studienschwerpunkt Heterogenität verpflichtend. Der<br />
Schwerpunkt liegt in den Bereichen der interkulturellen Bildung,<br />
der inklusiven Pädagogik und Deutsch als Zweitsprache.<br />
Immerhin, die ersten zaghaften Schritte sind in der Lehrerausbildung<br />
zu erkennen, wenngleich entschiedenes Handeln anders