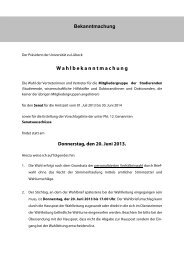(SILAS) für die minimal invasive Chirurgie - Universität zu Lübeck
(SILAS) für die minimal invasive Chirurgie - Universität zu Lübeck
(SILAS) für die minimal invasive Chirurgie - Universität zu Lübeck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2. Glück als Grundbedürfnis – Glück als Grundrecht?<br />
Es gilt, <strong>die</strong>sen letzten Fragen nach<strong>zu</strong>gehen. Gemäß Sigmund<br />
Freud mag selbst eine Illusion noch sinnvoll sein.<br />
„Für <strong>die</strong> Illusion bleibt charakteristisch <strong>die</strong> Ableitung<br />
aus menschlichen Wünschen, sie nähert sich in <strong>die</strong>ser<br />
Hinsicht der psychiatrischen Wahnidee, aber sie scheidet<br />
sich, abgesehen von dem komplizierten Aufbau der<br />
Wahnidee, auch von <strong>die</strong>ser. An der Wahnidee heben wir<br />
als wesentlich den Widerspruch gegen <strong>die</strong> Wirklichkeit<br />
hervor, während <strong>die</strong> Illusion nicht notwendig falsch, d.h.<br />
unrealisierbar oder im Widerspruch mit der Realität sein<br />
muss“ (8). Tatsächlich ist <strong>die</strong> Suche nach Glück ein Teil<br />
der Realität, und <strong>die</strong>se in ihrer Komplexität <strong>zu</strong> verstehen<br />
ist eine Aufgabe, <strong>die</strong> lösbar erscheint. Sie jedoch unter<br />
den Zeitbedingungen der Postmoderne mit dem Sturm<br />
der Beschleunigung und den anwachsenden „Trümmerhaufen“<br />
als lösbar <strong>zu</strong> erachten, ist eine Aufgabe von <strong>zu</strong>sätzlicher<br />
Komplexität.<br />
Es sind Bedingungen, unter welchen der einzelne Mensch<br />
schnell als überzählig gilt. Überzählig sein zerbricht den<br />
Grundwert des Menschseins, den Ich-Wert. Dessen Sicherheit<br />
<strong>zu</strong> spüren hängt tatsächlich, wie schon erläutert<br />
wurde, seit der frühesten Kindheit von der Art der Beachtung<br />
des Individuums in seinem Glücksbedürfnis ab.<br />
Interessanterweise entwickelte <strong>die</strong> französische Philosophin<br />
Simone Weil, <strong>die</strong> 1943 im Exil in London mit 34<br />
Jahren an den Folgen einer sich über Jahre fortsetzenden<br />
Anorexie starb (9), in ihrem letzten, kurz vor dem Tod<br />
abgeschlossenen Werk „Enracinement“ (10) (dt. „Einwurzelung“)<br />
eine Theorie der Grundbedürfnisse, <strong>die</strong> beachtenswert<br />
ist, gerade hinsichtlich deren Einbe<strong>zu</strong>gs in<br />
<strong>die</strong> psychoanalytischen Erkenntnisprozesse. Gemäß Simone<br />
Weil sind es <strong>die</strong> Grundbedürfnisse, <strong>die</strong> das körperliche<br />
und das psychische Leben jedes Menschen sowohl<br />
als Individuum wie als Teil einer Sozietät mitprägen. In<br />
der Befriedigung der Grundbedürfnisse sind <strong>die</strong> Menschen<br />
in wechselseitiger Abhängigkeit von einander; <strong>die</strong><br />
Art und der Wert deren Beachtung beeinflusst <strong>zu</strong>gleich<br />
den seelischen Zustand des einzelnen Menschen wie<br />
jede private Beziehung und jedes soziale Empfinden.<br />
Es ist <strong>die</strong> Nichterfüllung der Grundbedürfnisse, <strong>die</strong><br />
gemäß Simone Weil immer Hungererscheinungen bewirkt,<br />
ob es sich um Hunger nach emotionaler, nach körperlicher<br />
oder nach geistiger resp. intellektueller Nahrung<br />
handle. Die Verbindung des einen mit dem anderen<br />
äußert sich im psychischen Hunger<strong>zu</strong>stand, der tödlich<br />
sein kann. Dabei ist das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit<br />
der eigenen Existenz und nach guter Integration im sozialen<br />
Umfeld, nach liebevoller Zuwendung und Sicherheit<br />
ebenso prioritär wie dasjenige nach körperlicher<br />
Ernährung und nach einem Dach über dem Kopf, und<br />
<strong>die</strong>ses wiederum ebenso unverzichtbar wie jenes nach<br />
Freiheit und nach Würde, nach einer <strong>zu</strong>stimmungsfähigen<br />
Ordnung menschlichen Zusammenlebens ohne<br />
Diskriminierung und ohne Marginalisierung. Das Bedürfnis<br />
nach Glück nennt Simone Weil nicht. Es ist in<br />
alle Grundbedürfnisse miteinbezogen, resp. es besteht<br />
in deren Verbindung.<br />
Den vielfachen Hunger<strong>zu</strong>stand, der durch mangelnde<br />
Erfüllung der Grundbedürfnisse, durch Diskriminierung<br />
und Marginalisierung bewirkt wird, kannte Simone<br />
Weil durch ihre nahen Beobachtungen der politischen<br />
und sozialen Zustände in den Zwanzigerjahren bei der<br />
durch den Ersten Weltkrieg ausgebluteten Bevölkerung<br />
Frankreichs wie in den Dreißigerjahren bei der arbeitslosen<br />
oder industriell ausgebeuteten Arbeiterschaft,<br />
ebenso bei der <strong>zu</strong>nehmend entrechteten und bedrohten<br />
jüdischen Bevölkerung, <strong>zu</strong> welcher sie gehörte. Sie<br />
hatte den Philosophieunterricht aufgegeben und sich<br />
um Fabrikarbeit bemüht, sie hatte sich 1936 nach Spanien<br />
begeben und <strong>die</strong> durch den Bürgerkrieg bewirkte<br />
menschliche und politische Katastrophe kennen gelernt.<br />
Ebenso hatte sie eine persönliche Auseinanderset<strong>zu</strong>ng<br />
mit den von Gewalt und Angst geladenen Spannungen<br />
in Deutschland gewagt, als sie im Dezember 1932 nach<br />
Berlin fuhr, um kurz vor Hitlers Machtübernahme deren<br />
Ausmaß <strong>zu</strong> klären.<br />
Was Simone Weil in „Enracinement“ ausführt, ist ein<br />
Entwurf <strong>zu</strong>r Korrektur des menschlichen „décracinement“<br />
resp. der „Entwurzelung“, <strong>die</strong> sie als Folge der<br />
vielfach unerfüllten Grundbedürfnisse der Menschen erachtet.<br />
Die Tatsache, dass Grundbedürfnisse mit Grundrechten<br />
einhergehen, hängt gemäß ihren Überlegungen<br />
von einer Zwischenverbindung ab, gewissermaßen von<br />
einer zwischenmenschlichen Synapse, durch welche<br />
eine Realisierung gesichert werden kann. Von maßgeblicher<br />
Bedeutung ist <strong>für</strong> Simone Weil, dass <strong>die</strong> gleiche<br />
menschliche Bedürftigkeit als Grundlage <strong>für</strong> <strong>die</strong> gleiche<br />
Verbindlichkeit (fr. „obligation“) gilt, auf <strong>die</strong> Bedürfnisse<br />
anderer Menschen <strong>zu</strong> achten. Auf der Reziprozität<br />
der Verbindlichkeit gegenüber den Grundbedürfnissen<br />
beruht <strong>die</strong> Reziprozität der Grundrechte, vorausgesetzt,<br />
<strong>die</strong> Verbindlichkeit wird ernstgenommen. „La notion<br />
d’obligation prime celle de droit qui lui est subordonnée<br />
et relative” (11). Dabei erscheint mir wichtig, auf<br />
<strong>die</strong> Bedeutung des lat. „ligare – binden“ in „obligation“<br />
(lat. „obligare“) hin<strong>zu</strong>weisen, das sich auch in<br />
„religion“ (lat. „religare“) findet: analog <strong>zu</strong>r gleichen<br />
Verbindung aller Menschen resp. des Menschseins <strong>zu</strong>m<br />
Göttlichen besteht <strong>die</strong> Verbindung zwischen Mensch<br />
und Mensch im Menschsein. Doch während Religion im<br />
Verständnis Simone Weils allein der Aufmerksamkeit –<br />
FOCUS MUL 24, Heft 2 (2007) 119