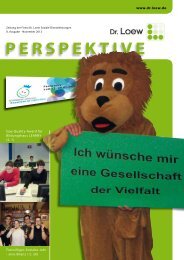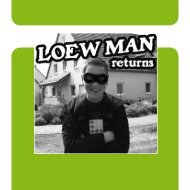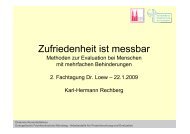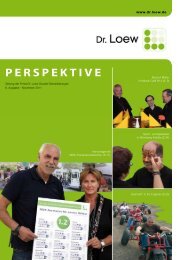Haus Gerolzhofen - Dr. Loew
Haus Gerolzhofen - Dr. Loew
Haus Gerolzhofen - Dr. Loew
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Lebensqualität aus Nutzersicht<br />
Wie Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen<br />
ihre Lebenssituation beurteilen<br />
Das Rehabilitationssystem befindet<br />
sich in einem grundlegenden Wandel,<br />
der gekennzeichnet ist durch eine Abkehr<br />
von einem Versorgungsmodell hin<br />
zu einer stärkeren Dienstleistungs- und<br />
Nutzerorientierung. Während in der<br />
Vergangenheit die Weiterentwicklung<br />
der Unterstützungssysteme nach fachlichen<br />
(„objektiven“) Leistungsstandards<br />
im Fokus stand, rückt zunehmend die<br />
Frage nach den Wirkungen der Unterstützungsangebote<br />
und deren Beurteilung<br />
durch die Nutzerinnen und Nutzer<br />
selbst in den Vordergrund (vgl. Oelerich<br />
& Schaarschuch 2005).<br />
Die traditionelle Behindertenhilfe ist<br />
noch weitgehend durch ein Versorgungsmodell<br />
gekennzeichnet, das<br />
wesentlich vom Gedanken der paternalistischen<br />
Fürsorge geprägt ist. Das<br />
zeigt sich darin, dass die Formulierung<br />
von Zielen und Standards überwiegend<br />
professionell dominiert ist und dabei<br />
der Fokus vor allem auf objektive Qualitätsmerkmale<br />
gesetzt wird. Die Perspektiven<br />
der Betroffenen werden nicht<br />
hinreichend berücksichtigt. Dabei erschöpft<br />
sich eine gute Leistungserbringung<br />
nicht darin, bestimmte strukturelle<br />
Bedingungen oder fachliche Standards<br />
einzuhalten. Die Leistungen müssen<br />
für die Nutzer auch einen subjektiven<br />
Gebrauchswert besitzen, sich also als<br />
relevant und sinnvoll für die eigene<br />
Lebensführung erweisen. Fragen, die<br />
dadurch in den Vordergrund rücken,<br />
sind: Inwiefern tragen Unterstützungsleistungen<br />
tatsächlich zur Verbesserung<br />
der Lebenslagen von Menschen<br />
mit Behinderung bei, zur Erweiterung<br />
von Teilhabechancen, zu Möglichkeiten<br />
der Alltagsbewältigung und zufrieden<br />
stellenden Lebensführung? Die Beantwortung<br />
dieser Fragen macht es erforderlich,<br />
die Nutzer der Angebote als<br />
„Experten in eigener Sache“ selbst zu<br />
Wort kommen zu lassen - sie sind also<br />
bei der Planung, Qualitätsdefinition und<br />
beurteilung von sozialen Dienstleistungen<br />
aktiv einzubeziehen.<br />
Mangelnde Ergebnisevaluation<br />
und Wirkungsorientierung in der<br />
Behindertenhilfe<br />
Eine konsequente Ergebnis- und Wirkungsorientierung<br />
ist in der deutschen<br />
Behindertenhilfe noch wenig ausgeprägt.<br />
In einer bundesweiten Studie<br />
von Wetzler (2003) wurde der Implementationsstand<br />
von Qualitätsmanagement<br />
in Wohnheimen untersucht.<br />
Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme<br />
verdeutlichen, dass ein Großteil der<br />
Wohneinrichtungen einzelne Verfahrenselemente<br />
der Qualitätssicherung<br />
einsetzt, diese Bemühungen aber vor<br />
allem die strukturierende Ebene der<br />
Leistungserstellung betreffen. Dass die<br />
Nutzerzufriedenheit eine wichtige Rolle<br />
bei der Qualitätsbeurteilung spielt,<br />
bejahen über 90% der Einrichtungen.<br />
Ergebnisevaluation wird aber nur von<br />
rund der Hälfte der Wohneinrichtungen<br />
vorgenommen, über ein <strong>Dr</strong>ittel sieht<br />
auch zukünftig keine derartigen Verfahren<br />
vor (vgl. Abb. 1). So kommt<br />
auch der erste Heimbericht der Bundesregierung<br />
zu dem Schluss: „Bezüglich<br />
des Leistungsgeschehens und<br />
der Qualitätssicherung liegen speziell<br />
für den Bereich der stationären Behindertenhilfe<br />
wenig aussagekräftige Informationen<br />
und Daten vor“ (BMFSFJ<br />
2006, 237).<br />
Vielerorts herrschen Vorbehalte hinsichtlich<br />
der Umsetzbarkeit nutzerorientierter<br />
Evaluationsverfahren – gerade<br />
wenn es sich bei den Nutzer/innen<br />
um Menschen mit geistiger Behinderung<br />
handelt. Dies mag zum einen<br />
damit zusammenhängen, dass diesem<br />
Personenkreis aufgrund kognitiv-kommunikativer<br />
Beeinträchtigungen häufig<br />
keine Urteilskompetenz zugestanden<br />
und ihre grundsätzliche Befragbarkeit<br />
angezweifelt wird.<br />
Zwar gibt es inzwischen vereinzelte Ansätze<br />
zur Nutzerbefragung. Diese halten<br />
jedoch wissenschaftlichen Kriterien<br />
kaum stand, da sie nicht theoriegeleitet<br />
auf systematischer Basis konstruiert,<br />
empirisch überprüft und für den weiteren<br />
Einsatz optimiert worden sind.<br />
von <strong>Dr</strong>. Markus Schäfers<br />
Abbildung 1<br />
SOZIALPOLITIK_<br />
In einer eigenen Studie (vgl. Schäfers<br />
2008) wurde ein solches Verfahren entwickelt,<br />
um so einen Beitrag zur dringend<br />
notwendigen Nutzerbefragung<br />
zu leisten und gleichzeitig der Lebensqualitätsbeurteilung<br />
zu dienen. Untersuchungs-<br />
und Handlungsfeld der Studie<br />
ist der stationäre Wohnbereich für<br />
Menschen mit Behinderung, einer der<br />
Kernbereiche traditioneller sozialer Angebote,<br />
der in Deutschland immerhin<br />
knapp 200.000 Plätze umfasst.<br />
Studie zur Entwicklung und<br />
Erprobung eines Instruments<br />
zur Lebensqualitätserhebung<br />
Zielsetzung der Studie war es, die methodischen<br />
Grundlagen für eine Lebensqualitätserhebung<br />
bei Menschen mit<br />
Behinderung zur nutzerorientierten Evaluation<br />
von Wohn- und Unterstützungsangeboten<br />
zu erarbeiten. Das Konzept<br />
„Lebensqualität“ dient deshalb als theoretische<br />
Basis, da es einen mehrdimensionalen<br />
Betrachtungsrahmen sowohl<br />
für die objektiven Lebensumstände als<br />
auch für die subjektive Wahrnehmung<br />
und Bewertung der Lebenssituation zur<br />
Verfügung stellt. Auf der Ebene der sozialen<br />
Dienste und Einrichtungen bietet<br />
das Konzept Lebensqualität ein wertvolles<br />
Bezugssystem zur Planung, Gestaltung<br />
und Evaluation sozialer Dienstleistungen.<br />
Die Arbeit liefert Zug um Zug alle<br />
notwendigen Bausteine für Nutzerbefragungen:<br />
Ergebnisse der Methodenforschung<br />
zur Befragung von Menschen mit<br />
geistiger Behinderung (insbesondere<br />
aus dem angloamerikanischen<br />
Sprachraum) wurden systematisiert.<br />
Das vorfindbare Instrumentenrepertoire<br />
zur Nutzer- und Lebensqualitätsbefragung<br />
(deutsch- und<br />
englischsprachig) wurde gesichtet,<br />
analysiert und bewertet.<br />
Darauf aufbauend wurde ein Instrument<br />
zur Erhebung von Lebensqualität<br />
bei Menschen mit geistiger<br />
Behinderung konstruiert, praktisch<br />
erprobt sowie systematisch getestet<br />
und optimiert.<br />
In einer Methodenanalyse wurde<br />
überprüft, inwieweit der methodische<br />
Zugang über die direkte<br />
Befragung dieser Zielgruppe zu gültigen<br />
Einschätzungen ihrer Sichtweisen<br />
führen kann.<br />
<strong>Dr</strong>.<strong>Loew</strong> PERSPEKTIVE 2009 7