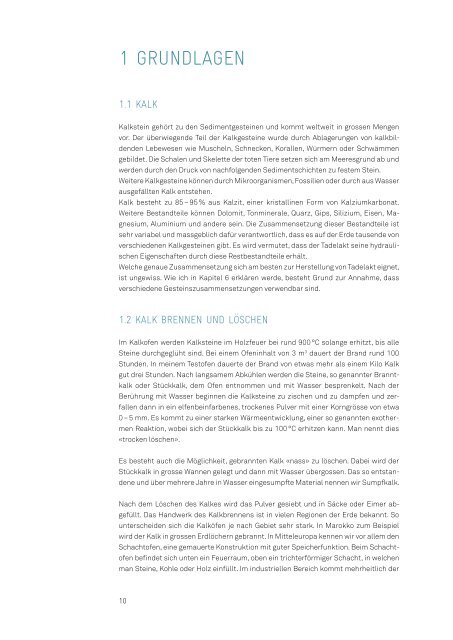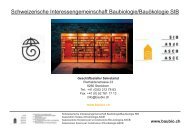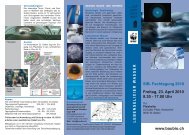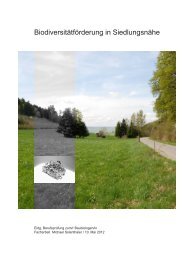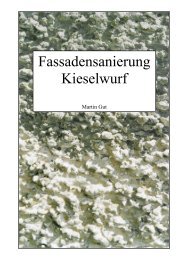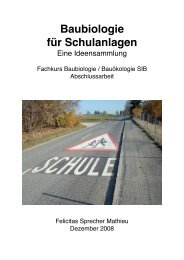Tadelakt_2011_Nr_285.pdf 1419KB 08.09.2012
Tadelakt_2011_Nr_285.pdf 1419KB 08.09.2012
Tadelakt_2011_Nr_285.pdf 1419KB 08.09.2012
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1 GRUNDLAGEN<br />
1.1 KALK<br />
Kalkstein gehört zu den Sedimentgesteinen und kommt weltweit in grossen Mengen<br />
vor. Der überwiegende Teil der Kalkgesteine wurde durch Ablagerungen von kalkbil-<br />
denden Lebewesen wie Muscheln, Schnecken, Korallen, Würmern oder Schwämmen<br />
gebildet. Die Schalen und Skelette der toten Tiere setzen sich am Meeresgrund ab und<br />
werden durch den Druck von nachfolgenden Sedimentschichten zu festem Stein.<br />
Weitere Kalkgesteine können durch Mikroorganismen, Fossilien oder durch aus Wasser<br />
ausgefällten Kalk entstehen.<br />
Kalk besteht zu 85 – 95 % aus Kalzit, einer kristallinen Form von Kalziumkarbonat.<br />
Weitere Bestandteile können Dolomit, Tonminerale, Quarz, Gips, Silizium, Eisen, Ma-<br />
gnesium, Aluminium und andere sein. Die Zusammensetzung dieser Bestandteile ist<br />
sehr variabel und massgeblich dafür verantwortlich, dass es auf der Erde tausende von<br />
verschiedenen Kalkgesteinen gibt. Es wird vermutet, dass der <strong>Tadelakt</strong> seine hydrauli-<br />
schen Eigenschaften durch diese Restbestandteile erhält.<br />
Welche genaue Zusammensetzung sich am besten zur Herstellung von <strong>Tadelakt</strong> eignet,<br />
ist ungewiss. Wie ich in Kapitel 6 erklären werde, besteht Grund zur Annahme, dass<br />
verschiedene Gesteinszusammensetzungen verwendbar sind.<br />
1.2 KALK BRENNEN UND LÖSCHEN<br />
Im Kalkofen werden Kalksteine im Holzfeuer bei rund 900 °C solange erhitzt, bis alle<br />
Steine durchgeglüht sind. Bei einem Ofeninhalt von 3 m 3 dauert der Brand rund 100<br />
Stunden. In meinem Testofen dauerte der Brand von etwas mehr als einem Kilo Kalk<br />
gut drei Stunden. Nach langsamem Abkühlen werden die Steine, so genannter Brannt-<br />
kalk oder Stückkalk, dem Ofen entnommen und mit Wasser besprenkelt. Nach der<br />
Berührung mit Wasser beginnen die Kalksteine zu zischen und zu dampfen und zer-<br />
fallen dann in ein elfenbeinfarbenes, trockenes Pulver mit einer Korngrösse von etwa<br />
0 – 5 mm. Es kommt zu einer starken Wärmeentwicklung, einer so genannten exother-<br />
men Reaktion, wobei sich der Stückkalk bis zu 100 °C erhitzen kann. Man nennt dies<br />
«trocken löschen».<br />
Es besteht auch die Möglichkeit, gebrannten Kalk «nass» zu löschen. Dabei wird der<br />
Stückkalk in grosse Wannen gelegt und dann mit Wasser übergossen. Das so entstan-<br />
dene und über mehrere Jahre in Wasser eingesumpfte Material nennen wir Sumpfkalk.<br />
Nach dem Löschen des Kalkes wird das Pulver gesiebt und in Säcke oder Eimer ab-<br />
gefüllt. Das Handwerk des Kalkbrennens ist in vielen Regionen der Erde bekannt. So<br />
unterscheiden sich die Kalköfen je nach Gebiet sehr stark. In Marokko zum Beispiel<br />
wird der Kalk in grossen Erdlöchern gebrannt. In Mitteleuropa kennen wir vor allem den<br />
Schachtofen, eine gemauerte Konstruktion mit guter Speicherfunktion. Beim Schacht-<br />
ofen befindet sich unten ein Feuerraum, oben ein trichterförmiger Schacht, in welchen<br />
man Steine, Kohle oder Holz einfüllt. Im industriellen Bereich kommt mehrheitlich der<br />
10