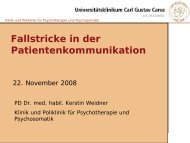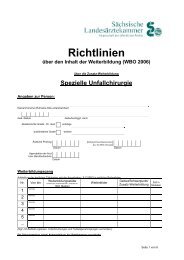Tätigkeitsbericht der Sächsischen Landesärztekammer 2001
Tätigkeitsbericht der Sächsischen Landesärztekammer 2001
Tätigkeitsbericht der Sächsischen Landesärztekammer 2001
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
genommen wird. Bei Vergleich <strong>der</strong> Qualitätsmerkmale, die als<br />
relevant anzusehen sind, muss jedoch festgestellt werden, dass<br />
Kliniken mit niedrigen Fallzahlen in einigen Positionen eindeutig<br />
zu hinterfragende Abweichungen vom Durchschnitt im<br />
Land Sachsen aufweisen.<br />
Für die Arbeitsgruppe Urologie ergibt sich daraus, wie schon<br />
erwähnt, die Konsequenz, diese über die Projektgeschäftsstelle<br />
Qualitätssicherung an <strong>der</strong> <strong>Sächsischen</strong> <strong>Landesärztekammer</strong> zu<br />
Auffälligkeiten zu befragen und gegebenenfalls auch in persönlichen<br />
Gesprächen Unterstützung anzubieten.<br />
5.5.2.5.<br />
Arbeitsgruppe Orthopädie<br />
(Prof. Dr. Rüdiger Franz, Dresden, Vorsitzen<strong>der</strong>)<br />
Die Arbeitsgruppe Orthopädie an <strong>der</strong> <strong>Sächsischen</strong> <strong>Landesärztekammer</strong><br />
setzt sich bereits seit dem Beginn ihrer Arbeit<br />
im Jahre 1999 paritätisch aus Vertretern <strong>der</strong> Fachrichtungen<br />
Orthopädie, Traumatologie und Wie<strong>der</strong>herstellungschirurgie,<br />
nie<strong>der</strong>gelassener Ärzte mit operativen Belegbetten und dem<br />
Medizinischen Dienst <strong>der</strong> Krankenkassen (MDK) zusammen.<br />
Auf Bundesebene wird an einer den praktischen Realitäten<br />
entsprechenden Zusammensetzung des zentralen Gremiums<br />
noch gearbeitet. Durch die Präsenz des Leiters <strong>der</strong> <strong>Sächsischen</strong><br />
Arbeitsgruppe in <strong>der</strong> Bundesgeschäftsstelle ergaben sich<br />
vielfältige Anregungen und Rückkoppelungen.<br />
Auf <strong>der</strong> Suche nach harten Daten <strong>der</strong> externen Qualitätssicherung<br />
im Sinne <strong>der</strong> evidenzbasierten Medizin konzentrierte<br />
sich die Arbeit im Berichtsjahr auf die Schwerpunkte:<br />
1. Infektionen und Antibiotikaprophylaxe,<br />
2. Phlebothrombose und <strong>der</strong>en Prophylaxe.<br />
1. Infektionen und Antibiotikaprophylaxe<br />
Das Auftreten einer Frühinfektion im Zeitraum <strong>der</strong> stationären<br />
Verweildauer ist stets ein Alarmsignal. Anhand des aufbereiteten<br />
Materials des Jahres 2000 wurde die Rate <strong>der</strong> Wundinfektionen<br />
von Abteilungen, die Prophylaxe übten, verglichen mit<br />
denen, die keine perioperative Antibiotikagabe für notwendig<br />
hielten (Tabelle 1). Nach Implantationen von Hüft-TEP ohne<br />
perioperative Prophylaxe lag die Infektionsrate mehr als zehnmal<br />
höher.<br />
Bei 4.454 Hüft-TEP-Implantationen (86 %) <strong>der</strong> 5.200 Fälle<br />
mit Antibiotikaprophylaxe des Jahres 2000 wurde <strong>der</strong> single<br />
shot praktiziert. Er erwies sich in <strong>der</strong> einmaligen Gabe (von<br />
zum Beispiel Cefazolin) i. v. 30 bis 60 Minuten vor <strong>der</strong><br />
Hautinzision als die wirksamste Prophylaxe.<br />
Die Auswertungen <strong>der</strong> Datensätze des Jahres 2000 aus 49<br />
Abteilungen ergab, dass Abteilungen mit kleinen Fallzahlen<br />
von unter 20 pro Jahr relativ mehr Wundinfektionen aufweisen<br />
als Kliniken mit Fallzahlen von über 100 Primärimplantationen<br />
im Jahr. In zwei Abteilungen mit Fallzahlen von < 20<br />
Implantationen liegen die Infektionsraten > 10 %, was Handlungsbedarf<br />
signalisiert.Auf dem Gebiet <strong>der</strong> Infektionen und<br />
<strong>der</strong>en Prophylaxe sind die Qualitätsmerkmale damit klar<br />
abgesteckt.<br />
Berufspolitik<br />
Tabelle 1: Wundinfektionen in Abhängigkeit von durchgeführter<br />
Antibiotikaprophylaxe<br />
49 Abteilungen in Sachsen im Jahr 2000<br />
Prophylaxe mit Ab Patienten Patienten mit Wundinfektion<br />
absolut relativ<br />
Ja 5.163 41 0,8 %<br />
Nein 37 3 8,1 %<br />
Gesamt 5.200 44 0,8 %<br />
2. Thromboseprophylaxe<br />
Ohne eine entsprechende Thromboseprophylaxe entwickeln<br />
nach Hüftgelenktotalendoprothesen zwischen 45 bis 57 % <strong>der</strong><br />
Patienten eine tiefe Beinvenenthrombose und bis zu 6 % erleiden<br />
tödliche Lungenembolien.<br />
Nach den Leitlinien <strong>der</strong> Deutschen Gesellschaft für Phlebologie<br />
zählen Hüftgelenkersatzoperationen damit zur höchsten<br />
Risikogruppe.<br />
In <strong>der</strong> Jahresauswertung 2000 führten nur 41 von 49 Kliniken<br />
bzw. Abteilungen eine hun<strong>der</strong>tprozentige Prophylaxe durch,<br />
wobei die Tendenz gegenüber dem Vorjahr steigend war. Empfohlen<br />
werden nie<strong>der</strong>molekulare Heparine (Fraxiparin<br />
gewichts-adaptiert o<strong>der</strong> Clexane 40, zugelassen ist auch Fragmin<br />
P forte 30 mg). Dieser For<strong>der</strong>ung kann sich im stationären<br />
Bereich keine Einrichtung entziehen. Das Problem besteht<br />
darin, dass nach <strong>der</strong> Beendigung des stationären Aufenthaltes<br />
das Thromboserisiko noch für drei bis vier Wochen weiterhin<br />
besteht. Hier spielen sich in <strong>der</strong> Praxis harte Auseinan<strong>der</strong>setzungen<br />
ab, weil <strong>der</strong> Praktische Arzt dies von seinem Budget<br />
her oft nicht realisieren kann, aber <strong>der</strong> Kliniker und <strong>der</strong><br />
aufgeklärte Patient das verlangen. Auch die Empfehlung: „...<br />
nie<strong>der</strong>molekulare Heparine bis die Mobilität vor <strong>der</strong> Operation<br />
wie<strong>der</strong> erreicht wird“ ist infolge Unschärfe nicht zur Klärung<br />
geeignet. Neue Erkenntnisse über das tatsächlich bestehende<br />
Risiko sind erfor<strong>der</strong>lich.<br />
5.6.<br />
Ärzte im Öffentlichen Dienst<br />
(Dr. Rudolf Marx, Mittweida, Vorstandsmitglied,<br />
Vorsitzen<strong>der</strong>)<br />
Wie bereits im <strong>Tätigkeitsbericht</strong> 2000 avisiert, befasste sich<br />
<strong>der</strong> Ausschuss im Jahr <strong>2001</strong> durchgängig mit dem Problem<br />
Schulsport in Sachsen.<br />
Angesichts <strong>der</strong> stetig zunehmenden Zahl von Teil- und<br />
Ganzbefreiungen, letztere beson<strong>der</strong>s in den Klassen 11 und 12,<br />
und dem permanenten Anstieg von Unfällen im Sportunterricht<br />
ist rasches Handeln geboten. Die Ursachen hierfür sind<br />
vielfältig, durch Analysen belegt und den Verantwortungsträgern<br />
bekannt. Es muss deshalb nichts beschönigt und<br />
nichts beklagt werden – ein praktikables Handlungskonzept ist<br />
in Zuständigkeit des <strong>Sächsischen</strong> Staatsministeriums für Kultus<br />
zu erstellen.<br />
255