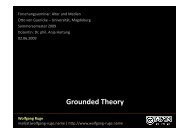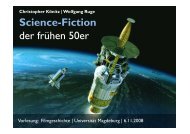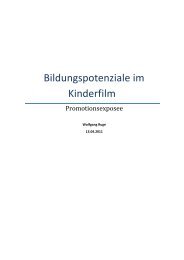Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Ruge</strong><br />
<strong>Von</strong> <strong>Descartes</strong> <strong>zu</strong> <strong>Deckard</strong> <strong>–</strong> Zur Identitätsfähigkeit künstlicher Intelligenzen im Science-Fiction-Film 41<br />
fester Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Für sie ist die Tatsache, dass sie eine Erinnerung an<br />
ihre Kindheit besitzt Beleg genug dafür, ein Mensch <strong>zu</strong> sein. Sie nimmt eine Kontinuität<br />
und Gleichheit ihrer selbst an und geht davon aus, dass auch <strong>Deckard</strong> diese (an-) erkennen<br />
muss. Somit besitzt sie sowohl eine personale als auch eine Ich-Identität im Sinne Eriksons.<br />
„Die wichtigste Botschaft des Identitätskonzepts von Erik H. Erikson ist die, dass sich Identität über das<br />
ganze Leben hin entwickelt, und ‚das Kernproblem der Identität‘, so kann man die Theorie<br />
<strong>zu</strong>sammenfassen, besteht ‚in der Fähigkeit des Ichs, angesichts des wechselnden Schicksals Gleichheit und<br />
Kontinuität aufrecht<strong>zu</strong>erhalten‘ (Erikson 1959b, S. 82). Erikson nennt das personale Identität. Wo dieses<br />
Bewusstsein mit dem Gefühl <strong>zu</strong>sammenkommt, ‚dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität<br />
erkennen‘, spricht er von Ich-Identität (Erikson 1946, S. 18)“ (Abels 2006, 285).<br />
Die Ich-Identität ist von Erikson als eine sozial-vermittelte gedacht. Ich ordne BLADE<br />
RUNNER dennoch dem Modus des Desengagements <strong>zu</strong>. Der Grund ist folgender: Die<br />
Erfahrungen, die das Selbst der Replikanten ausmachen, sind nicht sozial vermittelt,<br />
sondern implantiert. Somit wird auch die Sozialität, in der sich Identität konstituiert, nur<br />
implantiert und ist nicht die Quelle des Selbst. Die Quelle des replikantischen Selbst ist die<br />
implantierte Erinnerung, eine Essenz, die theoretisch in jeden beliebigen Körper<br />
integrierbar ist <strong>–</strong> wobei die Erinnerung natürlich auf einem materiellen Träger gespeichert<br />
werden muss, und somit das Ich nicht unabhängig vom Körper sein kann. Blade Runner<br />
vertritt dennoch <strong>Descartes</strong> mechanischtisches Weltbild.<br />
4.1.4 Mit fremden Augen sehen <strong>–</strong> die desengagierte Haltung <strong>zu</strong>r<br />
Wirklichkeit in Blade Runner<br />
Wie Georg Seeßlen und Fernand Jung (2003, 499) feststellen verweist schon der Name<br />
der Hauptperson Rick <strong>Deckard</strong><br />
„auf den Philosophen <strong>Descartes</strong>, dessen mechanistisches Weltbild <strong>zu</strong>r Doktrin geworden ist, und dessen<br />
Aussage ‚Ich denke, also bin ich‘ doch von den Replikanten gegen sie gewendet ist. Die Replikanten sind,<br />
weil sie denken, und sie sind besser, weil sie besser denken. Aber ihr Denken ist noch nicht befreit, es ist<br />
nicht nur künstlich […], sondern sich auch der Selbstbeschränkung bewusst“.<br />
Diese Künstlichkeit des replikantischen Denkens ist der Angriffspunkt der Blade<br />
Runner. In einem Test bedarf es in der Regel 20 Fragen, bis der Testende, aufgrund der<br />
fehlenden emotionalen Reaktion, sein Gegenüber als Replikant einordnen kann. Recht<br />
schnell ist <strong>zu</strong> sehen: der Getestete ist menschlich oder nicht. Eine zentrale Rolle spielt dabei<br />
das Auge, das als Motiv im Film omnipräsent ist. Jedoch steht es nicht für eine leibliche<br />
Verankerung menschlicher Erfahrung, sondern ist Repräsentant einer desengagierten