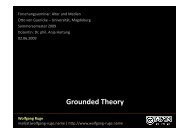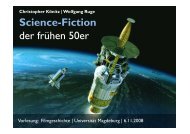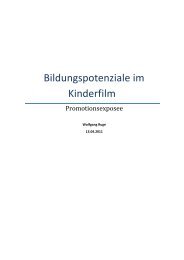Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Ruge</strong><br />
<strong>Von</strong> <strong>Descartes</strong> <strong>zu</strong> <strong>Deckard</strong> <strong>–</strong> Zur Identitätsfähigkeit künstlicher Intelligenzen im Science-Fiction-Film 52<br />
Nicht das natürliche Sujet 20 ist das auffälligste Unterscheidungsmerkmal des vitruvanischen<br />
Roboters gegenüber seinem Original, sondern ist auf der Ebene des konventionellen Sujets 21<br />
angesiedelt. Die Elemente, die beide Bilder kennzeichnen, ähneln sich: Durch die<br />
geometrischen Figuren des Kreises und des Quadrats eingerahmt, erkennt man einen<br />
Mensch (im Ganzen) oder einen Roboter (in Einzelteilen) sowohl in Ruhestellung, als auch<br />
mit ausgestreckten Extremitäten. Der Roboter ist dabei durchaus menschenähnlich.<br />
Dadurch, dass der Roboter in seine Einzelteile „zerlegt“ dargestellt wird, betont das Bild<br />
die Tatsache, dass dieser <strong>zu</strong>sammengesetzt werden muss. Der vitruvanische Roboter ist im<br />
Gegensatz <strong>zu</strong>m vitruvanischen Menschen kein Idealbild der Schönheit. Er ist eine Summe<br />
aus Teilen, die danach streben sich diesem Idealbild an<strong>zu</strong>nähern, es aber noch nicht<br />
geschafft haben. Die „Gemachtheit“ des Roboters wird betont, wodurch das abschließende<br />
Bild als Zusammenfassung für den Vorspann und die von Nova vertretene Meinung <strong>zu</strong>m<br />
Thema künstliches Bewusstsein gesehen werden kann: Roboter sind noch weit davon<br />
entfernt sich dem Idealbild des Menschen an<strong>zu</strong>nähern.<br />
Sein Bewusstsein erhält Nummer 5 auch nicht durch technische Brillanz seiner<br />
Schöpfer, sondern durch einen Zufall. Nach einer öffentlichen Demonstration seiner<br />
Fähigkeiten wird er <strong>zu</strong>m Aufladen der Batterien an einen Generator angeschlossen. Als ein<br />
Gewitter aufzieht kann das technische Personal ihn nicht rechtzeitig vom Stromnetz<br />
abtrennen, ein Blitz schlägt ein und durch<strong>zu</strong>ckt auch Nummer 5 (Badham 1986, 0:09:33-<br />
0:09:50). Nachdem er sich von den Folgen erholt hat, besitzt der Roboter ein Bewusstsein.<br />
Nicht die technische Fähigkeit der Menschheit hat einen bewussten Roboter geschaffen,<br />
sondern dieser wurde durch einen „göttlichen Funken“ geschaffen. Mit dem Blitz fährt, um<br />
einen Begriff Daniel Dennets <strong>zu</strong> gebrauchen auch der „inmaterial mind-stuff“ in seinen<br />
Körper.<br />
20 Der Begriff des natürlichen Sujets geht auf Panofsky <strong>zu</strong>rück, an anderer Stelle bezeichnet er die<br />
Beschreibung dessen als vorikonographisch: „Die Welt reiner Formen, die dergestalt als Träger primärer oder<br />
natürlicher Bedeutungen erkannt werden, mag die Welt der künstlerischen Motive heißen. Eine Aufzählung<br />
dieser Motive wäre eine vorikonographische Beschreibung des Kunstwerkes“ (Panofsky 1962, 32 zit nach<br />
Jörissen/Marotzki 2009, 102).<br />
21 In der ikonographischen Beschreibung des konventiellen Sujets geht es darum, die Bedeutung der<br />
dargestellten Objekte <strong>zu</strong> entschlüsseln (vgl. Jörissen/Marotzki 2009, 104<strong>–</strong>107).