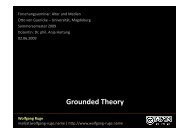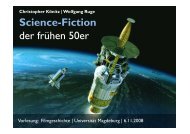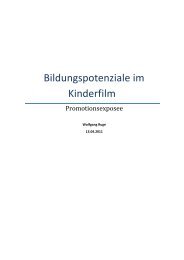Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Ruge</strong><br />
<strong>Von</strong> <strong>Descartes</strong> <strong>zu</strong> <strong>Deckard</strong> <strong>–</strong> Zur Identitätsfähigkeit künstlicher Intelligenzen im Science-Fiction-Film 45<br />
Es folgt eine weiche Überblendung, wir sehen den weiblichen Miniaturroboter, nun in<br />
der Mitte des Bildes sitzend; die menschliche Hand ist nicht mehr aktiv. Ein männlicher<br />
Miniaturroboter tritt von links in das Bild. Nach einem kurzen Blickwechsel, welcher wg.<br />
der fehlenden Augen der Roboter nur durch Kopfbewegungen angedeutet werden kann,<br />
setzt sich der männliche Roboter neben den weiblichen und legt einen Arm um ihn (Abb.<br />
27, Abb. 28). Die „Gestik“ der Roboter ist dabei der menschlichen sehr ähnlich, sodass<br />
sich relativ schnell zwei Deutungen entwickeln lassen: Die erste besagt, dass sich hier zwei<br />
Wesen kennen und lieben lernen. Die zweite Lesart basiert darauf, dass der weibliche<br />
Roboter eine leicht gebeugte Körperhaltung erkennen lässt, welche Trauer anzeigen<br />
könnte. In diesem Fall sehen wir eine Szene des Tröstens. Welche der beiden Lesarten auch<br />
immer bevor<strong>zu</strong>gt wird, der symbolische Gehalt der Sequenz lässt sich eindeutig<br />
rekonstruieren: Gezeigt wird, wie sich ein „gefertigtes Geschöpf“ buchstäblich aus den<br />
Händen seines Schöpfers emanzipiert. Diese Emanzipation gelingt durch das Ausleben<br />
urmenschlicher Gefühle - sei es nun Liebe, oder Trauer und Trost. Der Wandel von einem<br />
gefertigten Produkt <strong>zu</strong> einem Individuum geschieht also durch den Ausdruck von Gefühl.<br />
Dieser Gefühlsausdruck wird dabei in einem Modus inszeniert, welcher von Rudolf<br />
Arnheim als „Spiegelung in einen äußeren Vorgang“ beschrieben wird. In diesem Modus<br />
wird „äußerer Vorgang, irgend ein Stückchen Handlung, erfunden, das den seelischen<br />
Zustand des Handelnden spiegelt“ (Arnheim 1932, 152). Die Wahl dieser<br />
Inszenierungsstrategie erscheint dabei banal, sind die Miniaturroboter doch <strong>zu</strong> einfach<br />
gehalten, um andere Optionen der Gefühlsdarstellung - wie den Einsatz „reiner Mimik<br />
und Gestik“ oder die „Wirkung durch Dasein resp. Präsenz“ (<strong>zu</strong> den Formen der<br />
Darstellung seelischer Prozesse im Film vgl. Arnheim 1932, 146<strong>–</strong>152) - <strong>zu</strong> ermöglichen.<br />
Dennoch wird durch diese die Wahl, Gefühle durch eine Handlung aus<strong>zu</strong>drücken, auf ein<br />
Kennzeichen des Expressivismus verwiesen: Gefühle als konstitutives Element des inneren<br />
Selbst und somit auch Selbsterkenntnis bedürfen einer Artikulation und müssen somit von<br />
einem inneren in einen äußeren Vorgang transformiert werden.<br />
Ein Gefühl, dessen Wert von Herder besonders betont wird, ist das Gefühl der<br />
Neugierde:<br />
„Das Erkennen der Seele läßt sich also nicht ohne Gefühl des Wohl- und Übelseins, ohne die innigste<br />
geistige Empfindung der Wahrheit und Güte denken. Das Wort Neugierde, Verlangen nach<br />
Erkenntnissen, sie auf die leichteste, beste Weise <strong>zu</strong> sehen, sagt’s“ (Herder 1978, 400)