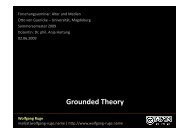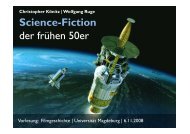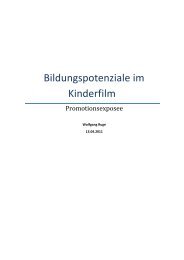Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Von Descartes zu Deckard – - Wolfgang Ruge
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Ruge</strong><br />
<strong>Von</strong> <strong>Descartes</strong> <strong>zu</strong> <strong>Deckard</strong> <strong>–</strong> Zur Identitätsfähigkeit künstlicher Intelligenzen im Science-Fiction-Film 7<br />
2 Vorüberlegungen und Begriffsklärungen<br />
2.1 Formen künstlicher Intelligenz<br />
Um begriffliche Unklarheiten <strong>zu</strong> vermeiden, möchte ich an dieser Stelle drei Formen<br />
künstlicher Intelligenzen im Science Fiction-Film kurz charakterisieren. Die von mir<br />
vorgeschlagene Trennung hat sich im Bereich der Science-Fiction mittlerweile etabliert,<br />
wird aber leider insbesondere in B-Produktionen häufiger falsch oder ungenau verwendet.<br />
Die drei Formen künstlicher Intelligenz sind: Roboter, Androiden und Cyborgs.<br />
Ein Roboter ist<br />
„eine Maschine ohne standardisiertes Äußeres, die dem Menschen die Arbeit abnehmen kann. Zusätzlich<br />
muss ein Roboter mit einem Aktuator ausgestattet sein, um auf seine Umwelt einwirken <strong>zu</strong> können, sonst<br />
könnte man ihn nicht von einem einfachen Computer abgrenzen“ (Recht 2002, 4).<br />
Ein Androide ist ein Roboter, der möglichst menschenähnlich gebaut wurde. Diese<br />
„künstlichen Menschen“ sind „überwiegend aus biologischen und evtl. auch<br />
elektronischen/mechanischen Teilen <strong>zu</strong>sammengesetzt“ (Hahn/Jansen 1985, 15) 3 .<br />
Der Cyborg hat eine längere Begriffsgeschichte 4 hinter sich und wurde letztendlich von<br />
Donna Harraway in eine feministische Figur umgedeutet 5 . In der Science-Fiction herrscht<br />
jedoch noch eindeutige Klarheit über den Cyborg-Begriff, welcher in einer technologischen<br />
Sichtweise definiert wird. Demnach ist der Cyborg „[e]in Hybride aus Mensch und<br />
Maschine“, ein Mensch „mit mechanischen/elektronischen Ersatzteilen, die [seinen]<br />
biologischen Körper bis auf das Gehirn ersetzen können“ (Hahn/Jansen 1985, 15).<br />
3 Markus Recht (2002, 5<strong>–</strong>6) unterscheidet noch zwischen Androiden und Replikanten. Androiden sind für<br />
ihn nur menschenähnlich aussehende Roboter, während Replikanten vollständig aus biologischem Material<br />
hergestellte Wesen sind. Als Beispiel für die beiden Formen nennt er Data aus Star Trek und die Replikanten<br />
aus Blade Runner. Diese genaue begriffliche Unterscheidung findet sich in der Science-Fiction jedoch eher<br />
selten und selbst der Autor Phillip K. Dick, der die Romanvorlage <strong>zu</strong> Blade Runner schrieb, spricht in seinem<br />
Titel von Androiden. Darüber hinaus stellen die „reinen“ nur biologischen und nur technischen Androiden<br />
eine Ausnahme dar. Die Regel sind Mischformen aus organischem und technischem Material. Ein Beispiel für<br />
diesen typischen Androiden stellt der - fälschlicherweise als Cyborg bezeichnete - Terminator dar, der ein<br />
mechanisches Innenleben besitzt, welches mit einer organischen Haut überzogen ist.<br />
4 Vgl. da<strong>zu</strong> (Wenner 2002).<br />
5 Vgl. da<strong>zu</strong> Donna Harraways Cyborg-Manifesto (Harraway 1991).