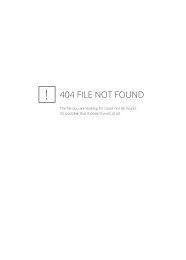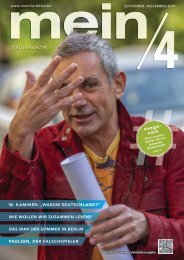mein/4 März 2020
mein/4 Stadtmagazin, Ausgabe März 2020
mein/4 Stadtmagazin, Ausgabe März 2020
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kultur im Kiez
Kirche zum Heilsbronnen
hinter einer von Stih & Schnock
beschilderten Laterne
Denkmal von Gerson Fehrenbach
Denk-Stein-Mauer der
Löcknitz-Grundschule
Ausstellung im Rathaus Schöneberg
sein Geschäft verkaufen musste und vier
Jahre später nach Łódź deportiert wurde,
wo er kurze Zeit später starb. Die heutige
Besitzerin, Christiane Fritsch-Weith,
die die Geschichte des Buchladens in
dem Dokumentationsband Klein, aber
voller Köstlichkeiten (Transit 2015, 17,80
€) aufgearbeitet hat, organisiert seit der
Geschäftsübernahme vor 45 Jahren mit
großem Erfolg Lesungen und Vorträge.
Ist der Andrang zu groß, weicht man in
die nahegelegene Kirche zum Heilsbronnen
aus, die bis zu 350 Personen
Platz bietet. Hier wurde der Gemeindesaal
kürzlich zum sogenannten HÖR-
Saal umgestaltet, der als neuer Veranstaltungsort
im Kiez etabliert werden soll.
Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen
und Vorträge sollen künftig das kulturelle
Programm bestimmen. Mit ihrem
68 Meter hohen Turm ist die 1912 eingeweihte
evangelische Kirche das zweithöchste
Gebäude des Viertels und das
einzige hier noch existierende historische
Gotteshaus. In den 1950er-Jahren wurden
die Ruinen zweier Synagogen abgetragen:
Das von Alexander Beer 1930
errichtete Gebäude in der Prinzregentenstraße,
das 2.300 Gläubigen Platz
bot, blieb der einzige Neubau einer Gemeindesynagoge
im Berlin der Weimarer
Republik. Es wurde während der Novemberpogrome
1938 niedergebrannt.
Diesem Schicksal entging die wesentlich
kleinere, von Max Fraenkel entworfene
und bereits 1910 eingeweihte Synagoge
in der Münchener Straße, da sie zu
nah an Wohnhäusern stand. Sie wurde,
wie ein Großteil des Bayerischen Viertels,
in der verheerenden Bombennacht
vom 22. auf den 23. November 1943
zerstört. Ein 1963 von Gerson Fehrenbach
gestaltetes Denkmal erinnert an
das Gotteshaus, auf dessen Grundstück
heute die Löcknitz-Grundschule steht.
Seit 1995 recherchieren die Schülerinnen
und Schüler der jeweils sechsten Klassen
Biografien ehemaliger jüdischer Nachbarinnen
und Nachbarn, von denen einst
16.000 im Bayerischen Viertel gelebt haben.
Mehr als 6.000 von ihnen wurden
1943 in Konzentrationslager deportiert,
viele gingen ins Exil oder wählten den
Freitod. Die Kinder beschriften in Gedenken
an sie Ziegelsteine mit Namen,
Geburtsdaten und Sterbeort, die einer
Denk-Stein-Mauer hinzugefügt werden
– ein jährlich wachsendes Denkmal
gegen das Vergessen.
Im Bayerischen Viertel findet man auch
zahlreiche von Gunter Demnigs Stolpersteinen,
die an das Schicksal von im Nationalsozialismus
verfolgten, vertriebenen
und ermordeten Menschen erinnern. Ein
weiteres dezentrales Mahnmal kann
man an 80 Straßenlaternen rund um den
Bayerischen Platz entdecken. Hier sind
in etwa drei Metern Höhe doppelseitig
gestaltete Schilder befestigt, auf deren
Textseite nationalsozialistische, antijüdische
Verordnungen und Gesetze den
schleichenden Prozess aufzeigen, der
schlussendlich zum Holocaust führte.
Die Rückseite der 1993 von Renata Stih
und Frieder Schock konzipierten Schilder
zieren assoziative Piktogramme, Bilder
und Symbole. Seit 2005 ergänzt die Ausstellungsinstallation
Wir waren Nachbarn
– Biografien jüdischer Zeitzeugen
die bereits genannten Projekte der Aufarbeitung
jüdischer Geschichte im Bezirk
Schönberg-Tempelhof: 172 biografische
Alben geben derzeit, gestützt auf
Interviews, Dokumente, Briefe und Fotos,
Auskunft über sehr unterschiedliche
Lebenswege bekannter und unbekannter
jüdischer Persönlichkeiten. Zu sehen
ist die Installation, die fortwährend weiterentwickelt
wird, in der großen Ausstellungshalle
des Schöneberger Rathauses,
das mit seinem markanten 70
Meter hohen Turm das höchste Gebäude
im Bayerischen Viertel darstellt. 1914
von dem Architektenduo Peter Jürgensen
und Jürgen Bachmann erbaut, war
es bis zur Gründung Groß-Berlins das
Rathaus der kreisfreien Stadt Schöneberg.
Von 1949 bis 1991 hatte der regierende
Bürgermeister Westberlins hier seinen
Amtssitz, in der Zeit der Berliner Teilung
war es auch Tagungsort des Berliner Abgeordnetenhauses.
Hier bekannte John
F. Kennedy am 26. Juni 1963: „Ich bin
ein Berliner!“, hier begannen am 2. Juni
1967 die Demonstrationen gegen den
Schahbesuch, hier läutet bereits seit dem
34 mein/4