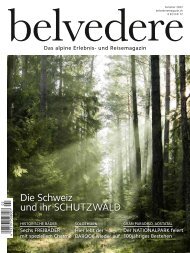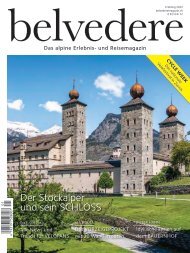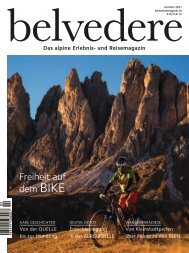belvedere Herbst 2021
«belvedere – das alpine Erlebnis- und Reisemagazin» bietet Informationen zu faszinierenden Destinationen, Beherbergungsbetrieben, Museen, Veranstaltungen, Persönlichkeiten, zu Brauchtum und kulinarischen Highlights zwischen den Provençalischen Alpen im Süden Frankreichs, über den Jurabogen und Alpengürtel in der Schweiz und den Österreichischen Alpen bis hin zu den Julischen Alpen in Slowenien. Der geografische Rahmen wird in jeder Ausgabe jedoch etwas sprengen. So steht denn «belvedere» nicht nur für spannende Reportagen zu Reisezielen in der Schweiz und in unseren Nachbarländern. Die Inhalte sind zusätzlich gespickt mit würzigen, süffig aufgemachten Geschichten zu weiteren reisenahen Themen und mit fantastischen Bildern ergänzt.
«belvedere – das alpine Erlebnis- und Reisemagazin» bietet Informationen zu faszinierenden Destinationen, Beherbergungsbetrieben, Museen, Veranstaltungen, Persönlichkeiten, zu Brauchtum und kulinarischen Highlights zwischen den Provençalischen Alpen im Süden Frankreichs, über den Jurabogen und Alpengürtel in der Schweiz und den Österreichischen Alpen bis hin zu den Julischen Alpen in Slowenien. Der geografische Rahmen wird in jeder Ausgabe jedoch etwas sprengen. So steht denn «belvedere» nicht nur für spannende Reportagen zu Reisezielen in der Schweiz und in unseren Nachbarländern. Die Inhalte sind zusätzlich gespickt mit würzigen, süffig aufgemachten Geschichten zu weiteren reisenahen Themen und mit fantastischen Bildern ergänzt.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Brandsee auf der<br />
Elsigenalp. Das<br />
idyllische Frutigland<br />
stellte früher jedes<br />
zweite Zündholz der<br />
Schweiz her.<br />
© ANJA ZURBRÜGG<br />
PHOTOGRAPHY<br />
I<br />
« han es Zündhölzli azündt, und das het e<br />
Flamme gäh…». Mani Matter beschreibt<br />
in diesem Mundartklassiker eindrucksvoll, wie<br />
durch das Entzünden eines Streichholzes, das<br />
versehentlich auf den Boden fällt, schlussendlich<br />
die Welt fast ins Elend gestürzt wird. Ob<br />
seiner Zündhölzli-Idee wohl die Geschichte des<br />
Frutiglands Pate stand? Schliesslich ist die<br />
Zündhölzli-Fabrikation im bernischen Frutigen<br />
tief verwurzelt – und Ursprung eines fast<br />
vergessenen Kapitels. Diese Geschichte hat<br />
kürzlich die Kulturgutstiftung Frutigland<br />
aufgearbeitet. Sie hat in Archiven und Bibliotheken<br />
umfassend recherchiert, Zeitzeugen befragt<br />
und diverse Originalgegenstände gesammelt.<br />
Entstanden ist ein umfassender Einblick in<br />
diesen regionalen Industriezweig und seine<br />
Folgen, welche in einer Broschüre dokumentiert<br />
sind. Dem Zündhölzli im Frutigland wurde gar<br />
ein eigenes Museum gewidmet, welches Ende<br />
Juli eröffnet hat. Das Thema ist nämlich<br />
nicht nur interessant, sondern auch relevant:<br />
Immerhin stellten im damaligen Amt Frutigen<br />
Ende des 19. Jahrhunderts bis zu 20 Fabriken<br />
Phosphor-, Schwefel- und Sicherheitshölzchen<br />
her – das waren rund 50 Prozent der gesamtschweizerischen<br />
Produktionsmenge.<br />
AUSWEG AUS DER ARMUT?<br />
Grosse Verbreitung fanden die Zündhölzer nach<br />
der Entwicklung des Phosphorzündholzes, und<br />
schon in der 1830er Jahren wurden diese in<br />
diversen europäischen Ländern fabrikmässig<br />
hergestellt. Die erste solche Fabrik in der<br />
Schweiz gründete der Deutsche Johann Friedrich<br />
Kammerer in Zürich Mitte der 1830er<br />
Jahre, und alsdann verbreitete sich die neue<br />
Industrie schnell - und primär in Gegenden mit<br />
grosser Armut. Denn dort waren genügend<br />
Leute bereit, zu mickrigen Löhnen die giftige<br />
Arbeit zu machen. So auch im Berner Oberland.<br />
Die erste Zündhölzlifabrik wurde 1850 gegründet<br />
und massgeblich vom damaligen Gemeinderat<br />
unterstützt. Denn die Errichtung der Fabrik<br />
würde zur Linderung der grassierenden Armut<br />
beitragen, so die Hoffnung. In der Tat war<br />
damals jeder Vierte in der Region abhängig von<br />
der «Armenkasse» – die Leute im Frutigland<br />
litten Hunger. Nachdem ein Brand ein Grossteil<br />
der Häuser zerstört und zu allem Überfluss auch<br />
HIN UND WEG<br />
noch eine Überschwemmung die Ernte zunichte<br />
gemacht hatte, fehlte es komplett an Perspektiven<br />
und die Menschen erhofften sich eine<br />
Verdienstmöglichkeit in der neuen Fabrik.<br />
Andere Optionen hatten sie auch nicht.<br />
GIFTE UND KINDERARBEIT<br />
In der Folge entstanden innerhalb von nur<br />
16 Jahren mehr als ein Dutzend weiterer solcher<br />
Zündhölzli-Fabriken im Frutigland – wobei es<br />
sich hierbei eigentlich um bessere Hütten<br />
handelte; eng, finster, dreckig und ohne Fenster<br />
oder Lüftungen. Die Fabrikarbeitenden verdienten<br />
im Jahr 1886 zwischen 60 Rappen und etwas<br />
mehr als 4 Franken – pro Tag notabene. Während<br />
die Männer für das Tunken, die Herstellung<br />
des Holzdrahtes und das Verpacken<br />
zuständig waren, erledigten die übrigen<br />
Arbeiten meist Frauen oder Kinder. Kinder<br />
erhielten für einen Tag Arbeit oft nur 10 Rappen<br />
– und ein Arbeitstag dauerte bis zu 14 Stunden.<br />
Zuerst wurde aus Tannenholz dünne Streifen<br />
geschnitten und diese dann auf die entsprechende<br />
Länge gekürzt. Anschliessend mussten<br />
sie in Rahmen eingespannt werden; diese<br />
filigrane Arbeit erledigten Kinder, die aufgrund<br />
ihrer feinen Finger besser hierfür «geeignet»<br />
waren. Schon Fünfjährige wurden für solche<br />
Arbeiten angeheuert. Schliesslich wurden die<br />
Hölzer in eine chemische Brennmischung<br />
getaucht und dann verpackt.<br />
KRANKHEITEN ALS FOLGE<br />
Die Kinderarbeit wurde zunächst nicht in Frage<br />
gestellt, und erst im Jahre 1870 kam ein Verbot<br />
der Kinderarbeit zur Abstimmung. Wenngleich<br />
dem Vorhaben ein heftiger Gegenwind entgegenblies<br />
– das Verbot der Kinderarbeit würde<br />
den Untergang der hiesigen Zündhölzli-Industrie<br />
bedeuten, hiess es. Nichtsdestotrotz wurde<br />
das Gesetz angenommen. Mit zweifelhaftem<br />
Erfolg: Die Kinder verrichteten nun einfach<br />
Heimarbeit, wo die Verhältnisse in hygienisch<br />
absolut unhaltbaren Zuständen noch prekärer<br />
waren. Die Küchenpfanne diente kurzerhand<br />
dazu, das giftige Phosphor zu ersitzen – und die<br />
lebensgefährlichen Dämpfe lagen somit permanent<br />
in der Luft. In den Fabriken akzentuierte<br />
sich dasselbe Problem: Da die Arbeiter den<br />
ganzen Tag dem giftigen Phosphor-Dampf<br />
<strong>belvedere</strong><br />
43