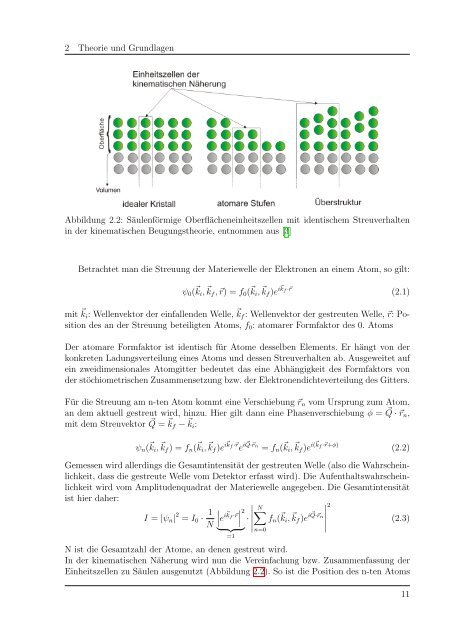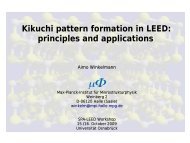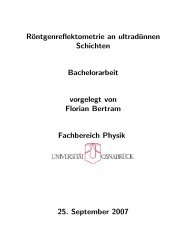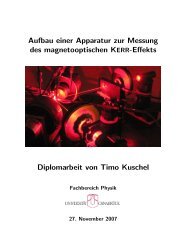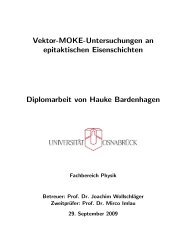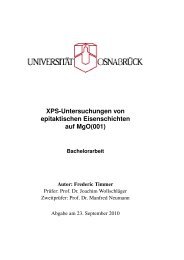Epitaktische Eisenschichten auf Ag(001) - AG Wollschläger ...
Epitaktische Eisenschichten auf Ag(001) - AG Wollschläger ...
Epitaktische Eisenschichten auf Ag(001) - AG Wollschläger ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2 Theorie und Grundlagen<br />
Abbildung 2.2: Säulenförmige Oberflächeneinheitszellen mit identischem Streuverhalten<br />
in der kinematischen Beugungstheorie, entnommen aus [3]<br />
Betrachtet man die Streuung der Materiewelle der Elektronen an einem Atom, so gilt:<br />
ψ0( � ki, � kf, �r) = f0( � ki, � kf)e i� kf ·�r<br />
(2.1)<br />
mit � ki: Wellenvektor der einfallenden Welle, � kf: Wellenvektor der gestreuten Welle, �r: Position<br />
des an der Streuung beteiligten Atoms, f0: atomarer Formfaktor des 0. Atoms<br />
Der atomare Formfaktor ist identisch für Atome desselben Elements. Er hängt von der<br />
konkreten Ladungsverteilung eines Atoms und dessen Streuverhalten ab. Ausgeweitet <strong>auf</strong><br />
ein zweidimensionales Atomgitter bedeutet das eine Abhängigkeit des Formfaktors von<br />
der stöchiometrischen Zusammensetzung bzw. der Elektronendichteverteilung des Gitters.<br />
Für die Streuung am n-ten Atom kommt eine Verschiebung �rn vom Ursprung zum Atom,<br />
an dem aktuell gestreut wird, hinzu. Hier gilt dann eine Phasenverschiebung φ = � Q · �rn,<br />
mit dem Streuvektor � Q = � kf − � ki:<br />
ψn( � ki, � kf) = fn( � ki, � kf)e i� kf ·�r e i � Q·�rn = fn( � ki, � kf)e i(� kf ·�r+φ)<br />
(2.2)<br />
Gemessen wird allerdings die Gesamtintensität der gestreuten Welle (also die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass die gestreute Welle vom Detektor erfasst wird). Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit<br />
wird vom Amplitudenquadrat der Materiewelle angegeben. Die Gesamtintensität<br />
ist hier daher:<br />
I = |ψn| 2 = I0 · 1<br />
N<br />
�<br />
�<br />
�e i�kf ·�r<br />
� 2<br />
� �� �<br />
=1<br />
�<br />
� � N� � �<br />
· �<br />
�<br />
n=0<br />
fn( � ki, � kf)e i � Q·�rn<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
2<br />
(2.3)<br />
N ist die Gesamtzahl der Atome, an denen gestreut wird.<br />
In der kinematischen Näherung wird nun die Vereinfachung bzw. Zusammenfassung der<br />
Einheitszellen zu Säulen ausgenutzt (Abbildung 2.2). So ist die Position des n-ten Atoms<br />
11