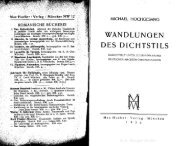Gottfried August Bürgers Einfluß August \filhelm Schlegel.
Gottfried August Bürgers Einfluß August \filhelm Schlegel.
Gottfried August Bürgers Einfluß August \filhelm Schlegel.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
64-<br />
mit sie ihren Sprachen die Vokale - also Stimmb, Gesang,<br />
Lebensodem, Seele- zugemessen haben; und dann<br />
auch in der Beschaffenheit". (tseispiele: ,,Schwarz,<br />
Sprung, Pfropf -")<br />
Aehnlich verhalten sich beide in der Beurteilung des<br />
Vokals e.<br />
B. (Wzt. S. 66 f.): ,,lm Vorbeigehn, ich wollte, dall<br />
der Henker wenigstens zwei Dritteile der vielen e in<br />
unserer Sprache holte! Vor diesen e kann fast gar keine<br />
musikalische Souorität aufkommen." I)ann vr'erden<br />
deutsche und italienische Verse verglichen mit dem Ergebnis<br />
(Wzb. 3. 67): ,,Schändlich, schändlich ist cs, daIJ<br />
dieser ,,E"-l'on sich überall aufdringt *-"<br />
Schl. rnacht (S. 175) den Versuch. die Vokale in ihrem<br />
Charakter symbolisch durch clie Farben des Regenbogens<br />
darzustellen, ein früher Anklang an die spätere<br />
romantische Mode der ,,audition color6e", der Symbolisierung<br />
von Klängen durch F--arben und umgekehrt. Dabei<br />
heißt es von €l ,,- I)as,,E" gehört durchaus nicht<br />
unter die Farben des Regenbogens - es ist grau. Ich<br />
habe nachher noch mehr Böses von ihm zu sagen."<br />
Dieses ,,Böse" steht S. 176: ,,Geschlossen aber, und<br />
Itauptsächlich ohne den 'l'on, wie der Infinitiv aller unserer<br />
Verben ,,sagen" u. s. u/. sagt es garnichts, sondern<br />
ist das treffendste Bild der Gleichgültigkeit."<br />
(Daza vgl. Min. I. 311. 6 f., wo sich Schl. ebenfalls<br />
iiber das e als den ,,Ausdruck der Gleichgültigkeit, die<br />
nothdürftigste Begleitung der Clonsonanten, um sie nur<br />
eben hörbar zu machen" beklagt und ebenso wie B. den<br />
\rokalreichtum des Althochdeutschen preist.)<br />
Im Konsonantismus macht B. auf den Unterschied<br />
zwischen der gutturalen 'und velaren Artikulation des<br />
Lautes ch aufmerksam (Wzb. 59), den der Grammatiker<br />
Adelung gänzliclt überseherr habe. .,lch meine die Verschiedenheiten<br />
nach a, o, u und nach ä, e, i, ö, ii -" B.<br />
unterscheidet zwischen ,,Ach"- und ,,lch"-I-auten, d. h.<br />
zwischen ,,gehauchten" und gepfiffenen". Wzb. S. 60<br />
wird angeführt, daß die Vokale die Laute: ch, auch wenn<br />
sie vorangehen, in dem .erwähnten Sinn 'beeinflussen.<br />
Das neugewonnene phonetische Gesetz, das B. in modern<br />
- 65-<br />
anmutender Weise auch lautphysiologisch erläutert, rvird<br />
auch auf g angewandt, soweit es in seiner hochdeutschen<br />
Aussprache mit ch zusammen fällt.<br />
Diese Untersuchung bildet zweiiellos die Grundlage<br />
der Schl.-schen Sätze auf S. 189: ,,Diesen Gurgellaut (ch)<br />
haben wir viel zu viel - ja wir sind solche Virtuosen<br />
darin, daß wir sogar ein doppeltes ch haben, da andere<br />
Nationen nur eine Art kennen. Das eine ch wird nach<br />
a, o, u, und au gesetzt: ach, auch - das andere, welches<br />
uns eigentümlich ist aber Ausländern unglaubliche<br />
Schwierigkeiten macht, (ein Umstand, auf den B. (Wzb.<br />
S. 59) hingewiesen hatte) steht nach i, e, ä, ö, und den<br />
Konsonanten: nicht, Furcht.<br />
Außerdem finden sich folgende Parallelen: Schl.<br />
S. 169: ,,G. ist




![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)