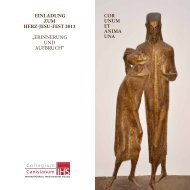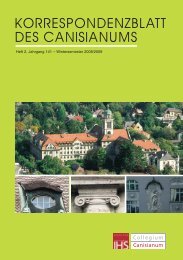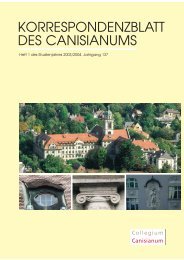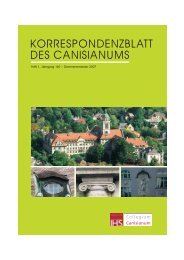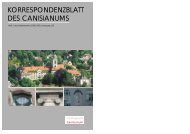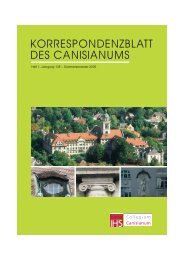Glaube, Hoffnung und Liebe – Bischofs - Canisianum
Glaube, Hoffnung und Liebe – Bischofs - Canisianum
Glaube, Hoffnung und Liebe – Bischofs - Canisianum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
den <strong>und</strong> hoffenden Menschen in der Kirche reflektiert<br />
(vgl. 9). Mit Hilfe des Modells des Dramas,<br />
das Schwager in seinen Veröffentlichungen Der<br />
w<strong>und</strong>erbare Tausch. Zur Geschichte <strong>und</strong> Deutung<br />
der Erlösunglehre (München 1986) <strong>und</strong> Jesus im<br />
Heilsdrama. Entwurf einer biblischen Erlösungslehre<br />
(Innsbruck-Wien 1990) entwickelte, lässt<br />
sich <strong>–</strong> wie Dietmar Regensburger hervorhebt <strong>–</strong><br />
„die biblische Offenbarungsgeschichte mit ihren<br />
vielfältigen Handlungsträgern <strong>–</strong> Jahwe, Volk, politische<br />
<strong>und</strong> religiöse Führergestalten, Propheten,<br />
Götzendiener, fremde Völker etc. <strong>–</strong> durch verschiedene<br />
geschichtliche Phasen hindurch verfolgen,<br />
ohne dass einerseits die Vielfalt der Erfahrungen<br />
gewaltsam auf eine einzige Perspektive<br />
reduziert werden muss <strong>und</strong> ohne dass andererseits<br />
die eine Geschichte in eine Vielfalt zusammenhangsloser<br />
Einzelepisoden zerfällt“ (87). So erweisen<br />
sich die fünf Akte des Dramas Jesu Christi<br />
(Verkündigung der Reich-Gottes-Botschaft,<br />
Ablehnung der Botschaft <strong>und</strong> Gerichtsworte,<br />
Kreuzigung, Auferstehung, Geistsendung) als<br />
kohärenter Neuansatz einer biblisch-systematischen<br />
Soteriologie <strong>und</strong> darüber hinaus als Kritik<br />
an Hauptströmungen der neuzeitlichen Anthropologie,<br />
welche die Autonomie des Subjekts über<strong>und</strong><br />
den Anspruch der jüdisch-christlichen Botschaft<br />
unterbewerteten (vgl. 16 f.).<br />
Was nun der Ansatz der „Dramatischen Theologie“<br />
für die einzelnen theologischen Disziplinen besagt,<br />
haben Józef Niewiadomski, Herwig Büchele,<br />
Gerhard Leibold, Roman Siebenrock, Wilhelm<br />
Guggenberger, Dietmar Regensburger, Wolfgang<br />
Palaver, Willibald Sandler, Nikolaus Wandinger,<br />
Andreas Vonach, Martin Hasitschka <strong>und</strong> Matthias<br />
Scharer aufschlussreich <strong>und</strong> kritisch-weiterführend<br />
gezeigt. So zeigt sich etwa <strong>–</strong> um den<br />
Beitrag von Roman Siebenrock herauszugreifen <strong>–</strong>,<br />
dass die Methode der „Korrelation“ im Licht der<br />
Dramatischen Theologie auf entscheidende Weise<br />
weiterentwickelt wird: Die Beziehung zwischen<br />
der Situation des Menschen <strong>und</strong> der Botschaft des<br />
<strong>Glaube</strong>ns versteht sich nicht als harmonische<br />
Verbindung, sondern als dramatischer Prozess:<br />
„Das Evangelium bejaht den Menschen gerade<br />
dadurch, dass es ihm eine gr<strong>und</strong>sätzliche Bekehrung<br />
zumutet <strong>und</strong> abverlangt“ (58).<br />
Das Buch schließt mit einer vollständigen Bibliografie<br />
(219<strong>–</strong>249), die Dietmar Regensburger<br />
erstellt hat. Somit liegt eine wichtige Dokumentation<br />
des theologischen Weges von Raym<strong>und</strong><br />
Schwager vor, das inzwischen für mehr als eine<br />
Generation von Theologiestudierenden in Innsbruck<br />
richtungweisend geworden ist. Dramatische<br />
Theologie <strong>–</strong> <strong>und</strong> Theologie überhaupt! <strong>–</strong> soll ja<br />
„ins Gespräch gebracht werden“, <strong>und</strong> genau dazu<br />
dient der vorliegende Band.<br />
Franz Gmainer-Pranzl<br />
Raatzsch, Richard:<br />
Eigentlich Seltsames.<br />
Wittgensteins Philosophische Untersuchungen.<br />
Band I: Einleitung <strong>und</strong> Kommentar PU 1-64.<br />
Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2003.<br />
ISBN 3-506-76000-9, 490 Seiten.<br />
Vorliegendes Werk kommentiert<br />
einen zentralen<br />
Text der Spätphilosophie<br />
von Ludwig Wittgenstein<br />
(1889<strong>–</strong>1951): die „PhilosophischenUntersuchungen“<br />
(PU). Wittgenstein<br />
hatte daran von 1936 bis<br />
1949 gearbeitet <strong>und</strong> dadurch<br />
eine Veränderung<br />
seiner Auffassung von<br />
„Sprache“ zum Ausdruck<br />
gebracht: Wurden im „Tractatus Logico-Philosophicus“<br />
(1918) <strong>–</strong> vereinfacht ausgedrückt <strong>–</strong> Sätze<br />
als „Abbild“ der Wirklichkeit verstanden, sehen die<br />
PU den Gebrauch der Sprache in einem regelgeleiteten<br />
„Spiel“ als entscheidend an.<br />
In der Einleitung (21<strong>–</strong>185) stellt Richard Raatzsch<br />
die Eigenart der zu interpretierenden Texte heraus:<br />
Die 693 Abschnitte des ersten Teils sowie die<br />
Ausführungen des zweiten Teils der PU weisen<br />
sowohl eine Präzision der Formulierung als auch<br />
eine locker-aphoristische Reihenfolge der Gedanken<br />
auf. „Es ist gewissermaßen die Unklarheit des<br />
Klaren, mit der wir es zu tun haben“ (46), bemerkt<br />
Raatzsch. Wittgensteins Texte sind eine Art „Schattenriss“<br />
(102), in denen sich <strong>–</strong> entgegen dem ersten<br />
Eindruck <strong>–</strong> durchaus eine Ordnung findet, „nur eben<br />
keine einfache lineare, sondern eine verschachtelte,<br />
wo sich zuweilen die Elemente überlappen“ (148).<br />
Das „Große Thema“ der ersten 65 Bemerkungen<br />
der PU, die in diesem Buch exegetisiert werden,<br />
53