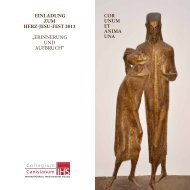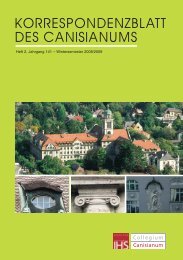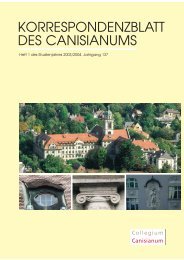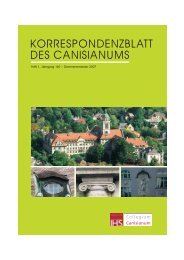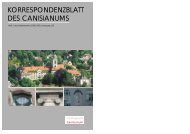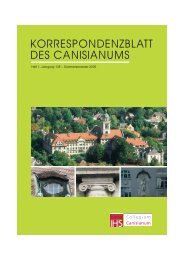Glaube, Hoffnung und Liebe – Bischofs - Canisianum
Glaube, Hoffnung und Liebe – Bischofs - Canisianum
Glaube, Hoffnung und Liebe – Bischofs - Canisianum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
steckter Gewaltstrukturen her ist verständlich, warum<br />
sich die spezifisch christliche Moral als „Ethik<br />
des Weges <strong>und</strong> gemeinsamen Gehens“ (126) versteht<br />
<strong>und</strong> in der Feier des eucharistischen Gedächtnisses<br />
ein gr<strong>und</strong>legendes „Gegenkonzept zur<br />
Sündenbockstruktur“ (133) zum Ausdruck kommt.<br />
In seinen Ausführungen zum kirchlichen Schuldbekenntnis<br />
am Ersten Fastensonntag 2000 verknüpft<br />
Nikolaus Wandinger (143<strong>–</strong>179) die Fähigkeit<br />
zur Vergebung <strong>–</strong> als Stehen zu vergangener<br />
Schuld <strong>und</strong> Umkehr der gesellschaftlichen Amnesietendenz<br />
<strong>–</strong> mit der Identität der Kirche als<br />
solcher.<br />
Der dritte gemeinsame Text (Der 11. September<br />
2001 <strong>und</strong> die Theologie der Zeichen der Zeit<br />
[182<strong>–</strong>196]) plädiert für ein ehrliches Benennen<br />
konkreter Spannungen <strong>und</strong> Differenzen im Dialog<br />
der Kulturen <strong>und</strong> Religionen, vor allem der „Frage<br />
der Gewalt“ (195). Dietmar Regensburger rät in<br />
seinem Aufsatz über die Zerstörung der „Twin<br />
Towers“ (197<strong>–</strong>216) zur Zurückhaltung, was religiöse<br />
Deutungen <strong>und</strong> eine <strong>–</strong> vor allem von den<br />
USA betriebene <strong>–</strong> „Schwarz-Weiß-Rhetorik“ (207)<br />
betrifft, <strong>und</strong> Wolfgang Palaver lenkt in seiner<br />
Analyse des Terrorismus (217<strong>–</strong>232) den Blick auf<br />
das „Ansteigen von Rivalitäts- <strong>und</strong> Neidpotentialen“<br />
(220) sowie auf die „pseudoreligiöse Seite“<br />
(222) des aktuellen Terrorismus.<br />
Der vierte gemeinsame Text (Israel <strong>und</strong> Palästina.<br />
<strong>Hoffnung</strong> in hoffnungsloser Situation [234<strong>–</strong>252])<br />
betont <strong>–</strong> angesichts dieses schier unlösbaren<br />
Konflikts <strong>–</strong>, dass letztlich wohl nur der „<strong>Glaube</strong> an<br />
den einen Schöpfergott“ (249) die Überzeugung<br />
von der Universalität der Menschenrechte begründen<br />
könne. Andreas Vonach arbeitet auf diesem<br />
Hintergr<strong>und</strong> die symbolische Bedeutung der Stadt<br />
Jerusalem für Judentum, Christentum <strong>und</strong> Islam<br />
heraus (253<strong>–</strong>269).<br />
Zwei Beiträge befassen sich mit dem Universitätslehrgang<br />
„Kommunikative Theologie“: Matthias<br />
Scharer (272<strong>–</strong>286) macht sein Anliegen deutlich:<br />
„Kommunikative Theologie versucht kommunikative<br />
Prozesse in Kirche <strong>und</strong> Gesellschaft theologisch<br />
zu verstehen“ (275), <strong>und</strong> Franz Weber<br />
(287<strong>–</strong>301) beschreibt dieses Konzept in weltkirchlichem<br />
Zusammenhang als einen „Prozess ständiger<br />
‚Ekklesiogenese‘“ (294). Abschließend erörtern<br />
Herwig Büchele <strong>und</strong> Erich Kitzmüller<br />
(304<strong>–</strong>363) die Möglichkeit einer gerechten, nichthegemonialen<br />
Weltordnung. Ihr Bef<strong>und</strong> lautet:<br />
„Unsere Weltgesellschaft verfügt über keine zen-<br />
56<br />
trale Autorität, die das weltweit-öffentliche<br />
gemeinsame Leben aus bewusster Entscheidung<br />
mitgestalten <strong>und</strong> mit-formen könnte“ (328 f.).<br />
Anzustreben sei eine „Wir-Gestalt der europäischen<br />
Integration“ (354), die ohne Opfer <strong>und</strong><br />
„Sündenbockstruktur“ (351) auskomme. Und in<br />
einem sehr gr<strong>und</strong>sätzlichen Sinn interpretiert<br />
Werner E. Ernst in seiner Sicht der biblischen<br />
Sündenfallserzählung (364<strong>–</strong>379) Gewalt als narzisstisch<br />
entfremdete Mimesis, die <strong>–</strong> gegen das<br />
Verbot, vom „Baum der Erkenntnis“ zu essen <strong>–</strong><br />
danach strebt, alles Nichtidentische anzugleichen;<br />
nur im Aushalten dieser Spannung ist Humanität<br />
möglich: „Erst des Guten Dominanz über das Böse<br />
bildet die Lösung, nicht aber Trennung“ (378).<br />
Der vorliegende Sammelband enthält ein reiches<br />
Potenzial an theologischer Inspiration <strong>und</strong> interdisziplinären<br />
Verknüpfungen; er bietet nicht einen<br />
glatten „Einspruch“ gegen die These, Religion erzeuge<br />
Gewalt, aber eine sorgfältige <strong>und</strong> differenzierte<br />
Herausarbeitung des gr<strong>und</strong>sätzlichen Anspruchs<br />
der biblischen Botschaft, Versöhnung <strong>und</strong><br />
Frieden zu ermöglichen <strong>–</strong> <strong>und</strong> das ist von<br />
unschätzbarer Bedeutung.<br />
Veröffentlichungen von Canisianern<br />
Franz Gmainer-Pranzl<br />
Joachim Kettel (Hg.)<br />
Josef Kardinal Frings.<br />
Leben <strong>und</strong> Wirken des Kölner Erzbischofs in<br />
Anekdoten.<br />
J. P. Bachern Verlag, Köln 2003,<br />
ISBN 3-7616-1670-8, 96 Seiten<br />
Bernd Elmar Koziel<br />
Kritische Rekonstruktion der Pluralistischen<br />
Religionstheologie John Hicks vor dem<br />
Hintergr<strong>und</strong> seines Gesamtwerks.<br />
Bamberger Theologische Studien, Band 17,<br />
Peter Lang, Frankfurt am Main 2001,<br />
ISBN 3-631-38039-9, 891 Seiten