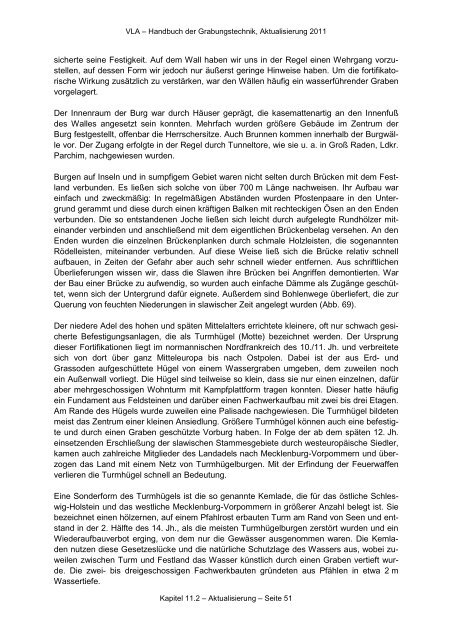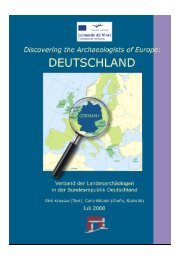11.2 Norddeutschland
11.2 Norddeutschland
11.2 Norddeutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
VLA – Handbuch der Grabungstechnik, Aktualisierung 2011<br />
sicherte seine Festigkeit. Auf dem Wall haben wir uns in der Regel einen Wehrgang vorzustellen,<br />
auf dessen Form wir jedoch nur äußerst geringe Hinweise haben. Um die fortifikatorische<br />
Wirkung zusätzlich zu verstärken, war den Wällen häufig ein wasserführender Graben<br />
vorgelagert.<br />
Der Innenraum der Burg war durch Häuser geprägt, die kasemattenartig an den Innenfuß<br />
des Walles angesetzt sein konnten. Mehrfach wurden größere Gebäude im Zentrum der<br />
Burg festgestellt, offenbar die Herrschersitze. Auch Brunnen kommen innerhalb der Burgwälle<br />
vor. Der Zugang erfolgte in der Regel durch Tunneltore, wie sie u. a. in Groß Raden, Ldkr.<br />
Parchim, nachgewiesen wurden.<br />
Burgen auf Inseln und in sumpfigem Gebiet waren nicht selten durch Brücken mit dem Festland<br />
verbunden. Es ließen sich solche von über 700 m Länge nachweisen. Ihr Aufbau war<br />
einfach und zweckmäßig: In regelmäßigen Abständen wurden Pfostenpaare in den Untergrund<br />
gerammt und diese durch einen kräftigen Balken mit rechteckigen Ösen an den Enden<br />
verbunden. Die so entstandenen Joche ließen sich leicht durch aufgelegte Rundhölzer miteinander<br />
verbinden und anschließend mit dem eigentlichen Brückenbelag versehen. An den<br />
Enden wurden die einzelnen Brückenplanken durch schmale Holzleisten, die sogenannten<br />
Rödelleisten, miteinander verbunden. Auf diese Weise ließ sich die Brücke relativ schnell<br />
aufbauen, in Zeiten der Gefahr aber auch sehr schnell wieder entfernen. Aus schriftlichen<br />
Überlieferungen wissen wir, dass die Slawen ihre Brücken bei Angriffen demontierten. War<br />
der Bau einer Brücke zu aufwendig, so wurden auch einfache Dämme als Zugänge geschüttet,<br />
wenn sich der Untergrund dafür eignete. Außerdem sind Bohlenwege überliefert, die zur<br />
Querung von feuchten Niederungen in slawischer Zeit angelegt wurden (Abb. 69).<br />
Der niedere Adel des hohen und späten Mittelalters errichtete kleinere, oft nur schwach gesicherte<br />
Befestigungsanlagen, die als Turmhügel (Motte) bezeichnet werden. Der Ursprung<br />
dieser Fortifikationen liegt im normannischen Nordfrankreich des 10./11. Jh. und verbreitete<br />
sich von dort über ganz Mitteleuropa bis nach Ostpolen. Dabei ist der aus Erd- und<br />
Grassoden aufgeschüttete Hügel von einem Wassergraben umgeben, dem zuweilen noch<br />
ein Außenwall vorliegt. Die Hügel sind teilweise so klein, dass sie nur einen einzelnen, dafür<br />
aber mehrgeschossigen Wohnturm mit Kampfplattform tragen konnten. Dieser hatte häufig<br />
ein Fundament aus Feldsteinen und darüber einen Fachwerkaufbau mit zwei bis drei Etagen.<br />
Am Rande des Hügels wurde zuweilen eine Palisade nachgewiesen. Die Turmhügel bildeten<br />
meist das Zentrum einer kleinen Ansiedlung. Größere Turmhügel können auch eine befestigte<br />
und durch einen Graben geschützte Vorburg haben. In Folge der ab dem späten 12. Jh.<br />
einsetzenden Erschließung der slawischen Stammesgebiete durch westeuropäische Siedler,<br />
kamen auch zahlreiche Mitglieder des Landadels nach Mecklenburg-Vorpommern und überzogen<br />
das Land mit einem Netz von Turmhügelburgen. Mit der Erfindung der Feuerwaffen<br />
verlieren die Turmhügel schnell an Bedeutung.<br />
Eine Sonderform des Turmhügels ist die so genannte Kemlade, die für das östliche Schleswig-Holstein<br />
und das westliche Mecklenburg-Vorpommern in größerer Anzahl belegt ist. Sie<br />
bezeichnet einen hölzernen, auf einem Pfahlrost erbauten Turm am Rand von Seen und entstand<br />
in der 2. Hälfte des 14. Jh., als die meisten Turmhügelburgen zerstört wurden und ein<br />
Wiederaufbauverbot erging, von dem nur die Gewässer ausgenommen waren. Die Kemladen<br />
nutzen diese Gesetzeslücke und die natürliche Schutzlage des Wassers aus, wobei zuweilen<br />
zwischen Turm und Festland das Wasser künstlich durch einen Graben vertieft wurde.<br />
Die zwei- bis dreigeschossigen Fachwerkbauten gründeten aus Pfählen in etwa 2 m<br />
Wassertiefe.<br />
Kapitel <strong>11.2</strong> – Aktualisierung – Seite 51