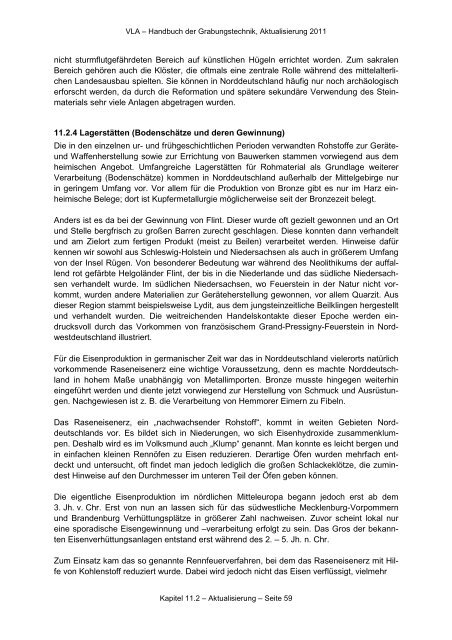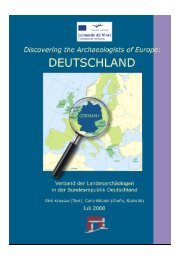11.2 Norddeutschland
11.2 Norddeutschland
11.2 Norddeutschland
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
VLA – Handbuch der Grabungstechnik, Aktualisierung 2011<br />
nicht sturmflutgefährdeten Bereich auf künstlichen Hügeln errichtet worden. Zum sakralen<br />
Bereich gehören auch die Klöster, die oftmals eine zentrale Rolle während des mittelalterlichen<br />
Landesausbau spielten. Sie können in <strong>Norddeutschland</strong> häufig nur noch archäologisch<br />
erforscht werden, da durch die Reformation und spätere sekundäre Verwendung des Steinmaterials<br />
sehr viele Anlagen abgetragen wurden.<br />
<strong>11.2</strong>.4 Lagerstätten (Bodenschätze und deren Gewinnung)<br />
Die in den einzelnen ur- und frühgeschichtlichen Perioden verwandten Rohstoffe zur Geräte-<br />
und Waffenherstellung sowie zur Errichtung von Bauwerken stammen vorwiegend aus dem<br />
heimischen Angebot. Umfangreiche Lagerstätten für Rohmaterial als Grundlage weiterer<br />
Verarbeitung (Bodenschätze) kommen in <strong>Norddeutschland</strong> außerhalb der Mittelgebirge nur<br />
in geringem Umfang vor. Vor allem für die Produktion von Bronze gibt es nur im Harz einheimische<br />
Belege; dort ist Kupfermetallurgie möglicherweise seit der Bronzezeit belegt.<br />
Anders ist es da bei der Gewinnung von Flint. Dieser wurde oft gezielt gewonnen und an Ort<br />
und Stelle bergfrisch zu großen Barren zurecht geschlagen. Diese konnten dann verhandelt<br />
und am Zielort zum fertigen Produkt (meist zu Beilen) verarbeitet werden. Hinweise dafür<br />
kennen wir sowohl aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen als auch in größerem Umfang<br />
von der Insel Rügen. Von besonderer Bedeutung war während des Neolithikums der auffallend<br />
rot gefärbte Helgoländer Flint, der bis in die Niederlande und das südliche Niedersachsen<br />
verhandelt wurde. Im südlichen Niedersachsen, wo Feuerstein in der Natur nicht vorkommt,<br />
wurden andere Materialien zur Geräteherstellung gewonnen, vor allem Quarzit. Aus<br />
dieser Region stammt beispielsweise Lydit, aus dem jungsteinzeitliche Beilklingen hergestellt<br />
und verhandelt wurden. Die weitreichenden Handelskontakte dieser Epoche werden eindrucksvoll<br />
durch das Vorkommen von französischem Grand-Pressigny-Feuerstein in Nordwestdeutschland<br />
illustriert.<br />
Für die Eisenproduktion in germanischer Zeit war das in <strong>Norddeutschland</strong> vielerorts natürlich<br />
vorkommende Raseneisenerz eine wichtige Voraussetzung, denn es machte <strong>Norddeutschland</strong><br />
in hohem Maße unabhängig von Metallimporten. Bronze musste hingegen weiterhin<br />
eingeführt werden und diente jetzt vorwiegend zur Herstellung von Schmuck und Ausrüstungen.<br />
Nachgewiesen ist z. B. die Verarbeitung von Hemmorer Eimern zu Fibeln.<br />
Das Raseneisenerz, ein „nachwachsender Rohstoff“, kommt in weiten Gebieten <strong>Norddeutschland</strong>s<br />
vor. Es bildet sich in Niederungen, wo sich Eisenhydroxide zusammenklumpen.<br />
Deshalb wird es im Volksmund auch „Klump“ genannt. Man konnte es leicht bergen und<br />
in einfachen kleinen Rennöfen zu Eisen reduzieren. Derartige Öfen wurden mehrfach entdeckt<br />
und untersucht, oft findet man jedoch lediglich die großen Schlackeklötze, die zumindest<br />
Hinweise auf den Durchmesser im unteren Teil der Öfen geben können.<br />
Die eigentliche Eisenproduktion im nördlichen Mitteleuropa begann jedoch erst ab dem<br />
3. Jh. v. Chr. Erst von nun an lassen sich für das südwestliche Mecklenburg-Vorpommern<br />
und Brandenburg Verhüttungsplätze in größerer Zahl nachweisen. Zuvor scheint lokal nur<br />
eine sporadische Eisengewinnung und –verarbeitung erfolgt zu sein. Das Gros der bekannten<br />
Eisenverhüttungsanlagen entstand erst während des 2. – 5. Jh. n. Chr.<br />
Zum Einsatz kam das so genannte Rennfeuerverfahren, bei dem das Raseneisenerz mit Hilfe<br />
von Kohlenstoff reduziert wurde. Dabei wird jedoch nicht das Eisen verflüssigt, vielmehr<br />
Kapitel <strong>11.2</strong> – Aktualisierung – Seite 59