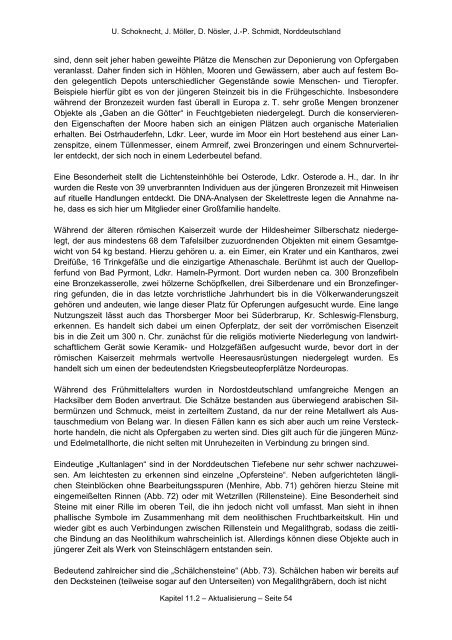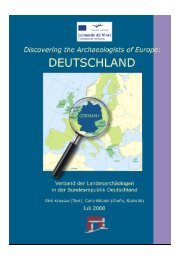11.2 Norddeutschland
11.2 Norddeutschland
11.2 Norddeutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
U. Schoknecht, J. Möller, D. Nösler, J.-P. Schmidt, <strong>Norddeutschland</strong><br />
sind, denn seit jeher haben geweihte Plätze die Menschen zur Deponierung von Opfergaben<br />
veranlasst. Daher finden sich in Höhlen, Mooren und Gewässern, aber auch auf festem Boden<br />
gelegentlich Depots unterschiedlicher Gegenstände sowie Menschen- und Tieropfer.<br />
Beispiele hierfür gibt es von der jüngeren Steinzeit bis in die Frühgeschichte. Insbesondere<br />
während der Bronzezeit wurden fast überall in Europa z. T. sehr große Mengen bronzener<br />
Objekte als „Gaben an die Götter“ in Feuchtgebieten niedergelegt. Durch die konservierenden<br />
Eigenschaften der Moore haben sich an einigen Plätzen auch organische Materialien<br />
erhalten. Bei Ostrhauderfehn, Ldkr. Leer, wurde im Moor ein Hort bestehend aus einer Lanzenspitze,<br />
einem Tüllenmesser, einem Armreif, zwei Bronzeringen und einem Schnurverteiler<br />
entdeckt, der sich noch in einem Lederbeutel befand.<br />
Eine Besonderheit stellt die Lichtensteinhöhle bei Osterode, Ldkr. Osterode a. H., dar. In ihr<br />
wurden die Reste von 39 unverbrannten Individuen aus der jüngeren Bronzezeit mit Hinweisen<br />
auf rituelle Handlungen entdeckt. Die DNA-Analysen der Skelettreste legen die Annahme nahe,<br />
dass es sich hier um Mitglieder einer Großfamilie handelte.<br />
Während der älteren römischen Kaiserzeit wurde der Hildesheimer Silberschatz niedergelegt,<br />
der aus mindestens 68 dem Tafelsilber zuzuordnenden Objekten mit einem Gesamtgewicht<br />
von 54 kg bestand. Hierzu gehören u. a. ein Eimer, ein Krater und ein Kantharos, zwei<br />
Dreifüße, 16 Trinkgefäße und die einzigartige Athenaschale. Berühmt ist auch der Quellopferfund<br />
von Bad Pyrmont, Ldkr. Hameln-Pyrmont. Dort wurden neben ca. 300 Bronzefibeln<br />
eine Bronzekasserolle, zwei hölzerne Schöpfkellen, drei Silberdenare und ein Bronzefingerring<br />
gefunden, die in das letzte vorchristliche Jahrhundert bis in die Völkerwanderungszeit<br />
gehören und andeuten, wie lange dieser Platz für Opferungen aufgesucht wurde. Eine lange<br />
Nutzungszeit lässt auch das Thorsberger Moor bei Süderbrarup, Kr. Schleswig-Flensburg,<br />
erkennen. Es handelt sich dabei um einen Opferplatz, der seit der vorrömischen Eisenzeit<br />
bis in die Zeit um 300 n. Chr. zunächst für die religiös motivierte Niederlegung von landwirtschaftlichem<br />
Gerät sowie Keramik- und Holzgefäßen aufgesucht wurde, bevor dort in der<br />
römischen Kaiserzeit mehrmals wertvolle Heeresausrüstungen niedergelegt wurden. Es<br />
handelt sich um einen der bedeutendsten Kriegsbeuteopferplätze Nordeuropas.<br />
Während des Frühmittelalters wurden in Nordostdeutschland umfangreiche Mengen an<br />
Hacksilber dem Boden anvertraut. Die Schätze bestanden aus überwiegend arabischen Silbermünzen<br />
und Schmuck, meist in zerteiltem Zustand, da nur der reine Metallwert als Austauschmedium<br />
von Belang war. In diesen Fällen kann es sich aber auch um reine Versteckhorte<br />
handeln, die nicht als Opfergaben zu werten sind. Dies gilt auch für die jüngeren Münz-<br />
und Edelmetallhorte, die nicht selten mit Unruhezeiten in Verbindung zu bringen sind.<br />
Eindeutige „Kultanlagen“ sind in der Norddeutschen Tiefebene nur sehr schwer nachzuweisen.<br />
Am leichtesten zu erkennen sind einzelne „Opfersteine“. Neben aufgerichteten länglichen<br />
Steinblöcken ohne Bearbeitungsspuren (Menhire, Abb. 71) gehören hierzu Steine mit<br />
eingemeißelten Rinnen (Abb. 72) oder mit Wetzrillen (Rillensteine). Eine Besonderheit sind<br />
Steine mit einer Rille im oberen Teil, die ihn jedoch nicht voll umfasst. Man sieht in ihnen<br />
phallische Symbole im Zusammenhang mit dem neolithischen Fruchtbarkeitskult. Hin und<br />
wieder gibt es auch Verbindungen zwischen Rillenstein und Megalithgrab, sodass die zeitliche<br />
Bindung an das Neolithikum wahrscheinlich ist. Allerdings können diese Objekte auch in<br />
jüngerer Zeit als Werk von Steinschlägern entstanden sein.<br />
Bedeutend zahlreicher sind die „Schälchensteine“ (Abb. 73). Schälchen haben wir bereits auf<br />
den Decksteinen (teilweise sogar auf den Unterseiten) von Megalithgräbern, doch ist nicht<br />
Kapitel <strong>11.2</strong> – Aktualisierung – Seite 54