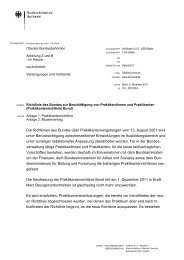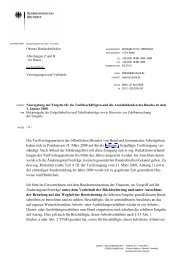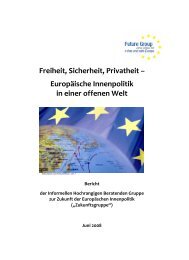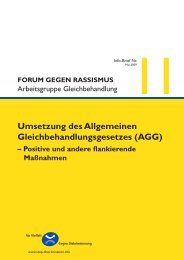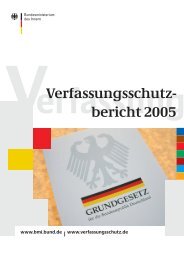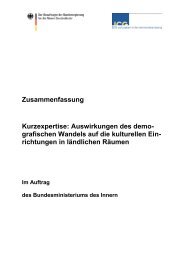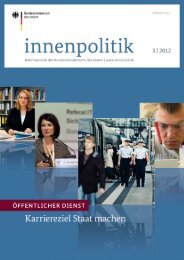TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DIE KULTURELLE ENTWICKLUNG DER KOLONIEN<br />
NEURUSSLANDS IM 19. JHDT – BS 6<br />
Kirche und Schule<br />
Für viele Kolonisten war die Einwanderung nach Russland erst durch die Zusage der Religionsfreiheit erstrebenswert<br />
gewesen. Bei den Mennoniten und Separatisten aus Südwestdeutschland war dies sogar der Ausschlag gebende<br />
Grund. Die ersten Geistlichen, ein lutherischer und ein calvinistischer Pastor sowie ein katholischer Pater und je ein<br />
Küster, wurden auf Beschluss der russischen Regierung vom 3. November 1763 in die Wolgakolonien entsandt. Ihr<br />
Gehalt zahlt die Regierung zwei Jahre lang. Danach sollen die Kolonisten die Besoldung der Geistlichen selbst übernehmen<br />
und die Auslagen der ersten zwei Jahre nach Ablauf von zehn Jahren dem Staat in Raten zurückerstatten.<br />
Die Gehälter für die Geistlichen werden wegen der anfänglichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und aus diversen<br />
anderen Gründen vom Saratower Tutelkontor übernommen.<br />
Auch die Kosten für den Bau von Kirchen und Bethäusern werden von diesem Kontor übernommen, alle diese Auslagen<br />
sollen nach Ablauf der Freijahre an die Krone zurückerstattet werden.<br />
Im Januar 1765 wird die Errichtung von Gotteshäusern in jedem Kreis gestattet und bereits 1768 die ersten beiden<br />
Kirchen mit Pastorat und Schule gebaut. Bis Ende des Jahres 1771 hat jeder Kreis der Wolgakolonien eine Kirche<br />
und die dazugehörige Schule.<br />
Die Geistlichen sollten aber nicht nur als Seelsorger im kirchlichen Rahmen wirken, sondern auch zur Stärkung von<br />
Sitte und Moral beitragen und durch Ermahnung zu besserer Arbeitshaltung die wirtschaftliche Entwicklung der<br />
Kolonien fördern. Die Seelsorge ist aber, abgesehen von den materiellen Problemen der Geistlichen, unbefriedigend<br />
geregelt. Nicht alle Pfarrstellen können besetzt werden, und daher werden zunächst Seelsorger aus dem Ausland<br />
eingeladen.<br />
Eine evangelisch-theologische Fakultät gibt es in Russland erst mit der Gründung der Universität zu Dorpat (heute<br />
Tartu) im Jahre 1802. Sie hat aber vor allem für den Priesternachwuchs der baltischen Provinzen und der Hauptstädte<br />
zu sorgen. Der erste Absolvent dieser Universität kommt 1854 in die Kolonien von Transkaukasien. Kolonistensöhne<br />
haben erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in größerer Zahl in Dorpat studiert.<br />
Die Schulfrage ist eng mit der Kirchenfrage verbunden. Sowohl die Protestanten als auch Katholiken legen großen<br />
Wert auf eine sorgfältige Ausbildung der Geistlichkeit und auf die Verbreitung von Elementarkenntnissen im Volk.<br />
Da die Einwanderer aus ihrer Heimat die Volksschule kennen, ist es nicht verwunderlich, dass sie nicht nur während<br />
der Anreise „Schule hielten“, sondern sogleich nach der Ansiedlung bestrebt sind, Schulen für ihre Kinder zu schaffen.<br />
In der ersten Zeit nach der Einwanderung gibt es noch genügend Gebildete, die das Lehramt ausüben können. Im<br />
Jahre 1782 aber entfällt die Besoldung der Lehrer durch das Tutelkontor, und man geht zur Unsitte über, das Lehramt<br />
demjenigen zu übertragen, der dafür das geringste Entgelt fordert.<br />
Im Jahre 1865 gibt es in den Wolgakolonien 175 kirchliche Schulen, in denen 22.046 Knaben und 21.223 Mädchen<br />
von 214 Lehrern unterrichtet werden. Das sind 247 Kinder pro Schule oder 202 Kinder pro Lehrer. Wohlhabende<br />
Kolonisten schickten ihre Kinder auf höhere russische Schulen oder lassen sie von Privatlehrern unterrichten.<br />
Die Situation in den Kolonien Südrusslands unterscheidet sich von der an der Wolga recht deutlich. Das liberale<br />
Schulgesetz für Wolhynien, Kiew und Polodien findet auch in den Kolonien Neurusslands Anwendung. Hier sind<br />
Geldsammlungen für schulische Zwecke erlaubt. Zudem ist es angesichts des Wohlstandes der Kolonien leichter,<br />
zusätzliche Gelder zu sammeln. Das beste Beispiel für Wohltätigkeit durch Privatinitiative gibt es in der deutschen<br />
Gemeinde zu Odessa.<br />
Auf Veranlassung von Pfarrer Fletnizer wird 1829 eine Sammlung für eine Schule durchgeführt. In dieser Schule<br />
werden die Fächer Deutsch, Russisch, Französisch, Arithmetik, Rechtschreiben, Geographie, Geometrie, Geschichte,<br />
Naturkunde, Technologie, Gesang und Malen unterrichtet. Neben dieser Schule wird in Odessa durch die Initiative<br />
der Geistlichkeit bereits 1823 eine Armenkasse und 1831 ein Altersheim gegründet; später kommen ein Hospital<br />
und ein Waisenhaus dazu. In der Mitte des Jahrhunderts folgt eine Realschule, eine Handelsschule und Kurse für<br />
Mädchen.<br />
Alle diese Einrichtungen werden jahrzehntelang durch die Spenden der Gemeindemitglieder finanziert. Zu Beginn<br />
des 20. Jahrhunderts hat jedes Kolonistengebiet Neurusslands eine Zentralbildungsanstalt zur Ausbildung von Lehrern<br />
und Schreibern. Zur selben Zeit werden in Georgien Ackerbauschulen und Progymnasien, in Tiflis ein Realgymnasium,<br />
in Helenendorf eine Oberrealschule gegründet, um nur einige zu nennen.<br />
<strong>TB</strong> 15<br />
21