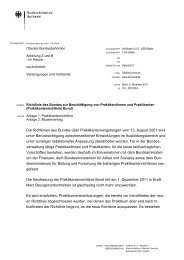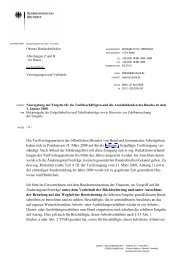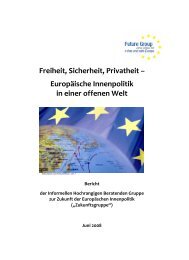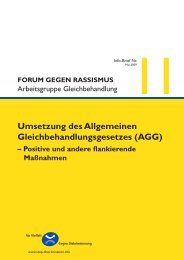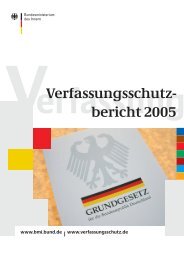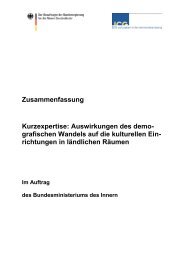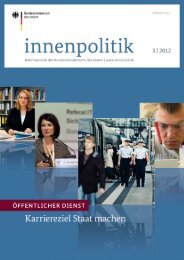TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>TB</strong><br />
38,2<br />
62<br />
AUTONOMIEBEWEGUNG – DIE SITUATION IN DER<br />
GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN (GUS) – BS 19<br />
Im Sommer 1992 wurden neue Hoffnungen genährt. Am 23. April 1992 unterzeichneten der damalige<br />
Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen Horst Waffenschmidt (MdB) und für die Russische<br />
Regierung Minister Valerij Tischkow das „Protokoll über die Zusammenarbeit zur stufenweisen Wiederherstellung<br />
der Staatlichkeit der Russlanddeutschen“.<br />
In einem ersten Schritt sollte nach einem Erlass von Präsident Jelzin vom 21. Februar 1992 im Gebiet<br />
Saratow ein erster deutscher Landkreis an der Wolga ausgebaut werden (das Vorhaben war zu diesem<br />
Zeitpunkt jedoch durch das Moratorium über Gebietsveränderungen nicht realisierbar). Ihm sollte im Gebiet<br />
Wolgograd ein Okrug (Bezirk, dessen Einwohner überwiegend einer Minderheit angehören) folgen.<br />
Umgesetzt wurde das Vorhaben indes nicht. Lediglich in den Orten Bogdaschkino und in Galki, die beide<br />
im Gebiet Wolgograd liegen, konnte je ein deutscher Gemeinderat eingesetzt werden.<br />
In den verschiedenen Regionen und Staaten mündete die Diskussion um die Autonomie und die Taktik<br />
der russischen Regierung in wenig konkrete Überlegungen, Russlanddeutsche zum Beispiel in Kaliningrad,<br />
auf der Krim und in Jekaterinenburg anzusiedeln. In diese Zeit fällt auch das Angebot des damaligen<br />
ukrainischen Präsidenten Leonid Krawtschuk vom 23. Januar 1992, in dem er 400000 Deutschen<br />
aus Sibirien, Kasachstan und Mittelasien die Ansiedlung in der Ukraine in Aussicht stellte.<br />
Kulturautonomie<br />
1996 beschloss die russische Regierung die Kulturautonomie als Lösung der Nationalitätenfrage. Am<br />
19./20. Dezember 1997 wurde die Konstituierung einer „Nationalkulturellen Autonomie“ der Russlanddeutschen<br />
in Gang gesetzt. Die Kulturautonomie beinhaltet die Gewährung größerer kultureller<br />
Selbstbestimmung in eigenen Bildungs- und Kultureinrichtungen, jedoch ohne ein eigenes Territorium.<br />
Das „Programm für die Entwicklung der sozial-ökonomischen und kulturellen Basis für die ,Wiedergeburt'<br />
der Russlanddeutschen für die Jahre 1997 bis 2006“ im August 1997 sieht eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen<br />
in 21 Republiken, Regionen und Gebieten Russlands vor. „Zur Finanzierung sollen Mittel<br />
aus dem Haushalt Russlands und der beteiligten Regionen und Gebiete sowie Mittel aus Deutschland<br />
eingesetzt werden. In den in Aussicht genommenen zehn Jahren würde es möglich sein, über 100000<br />
Umsiedler vor allem aus GUS-Republiken aufzunehmen, über 22000 Arbeitsplätze zu schaffen und circa<br />
1470000 Hektar Land zu bewirtschaften“ (Eisfeld 1999). Am 19./20. Dezember 1997 fand in Moskau<br />
der Gründungskongress der föderalen Kulturautonomie statt, unter dessen Dach die lokalen Kulturautonomien<br />
zusammengefasst werden sollen.<br />
Die Erwartungen der deutschen Minderheit an die Kulturautonomie waren gespalten. Einerseits wurden<br />
neue Impulse zur Stabilisierung der Minderheitensituation durch den Ausbau der deutschen Sprache<br />
und Kultur erwartet. Andererseits kritisierte zum Beispiel Alexander Fahrenbruch (damaliger Vorsitzender<br />
der „Wiedergeburt“ in der Russländischen Föderation) die rechtliche und finanzielle Basis der Kulturautonomie:<br />
„Das Gesetz über die nationale Kulturautonomie sieht die Schaffung einer gesellschaftlichen<br />
Struktur vor, die direkt in das staatliche System eingebunden ist. Und nicht zu vergessen die Finanzierung<br />
durch den Staat, die dem Gesetz nach möglich ist – sie kann funktionieren oder auch nicht, ist also völlig<br />
vom Staat [...] abhängig“ (Neues Leben, 23. Dezember 1996). In einer gemeinsamen Erklärung betonten<br />
elf russlanddeutsche Verbände, dass die Kulturautonomie in keiner Weise die Frage einer territorialen<br />
Autonomie löse, sahen sie aber als Ansatzpunkt für weitere Schritte an.