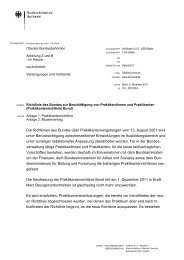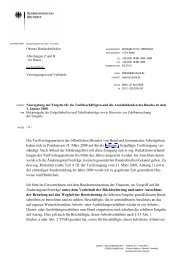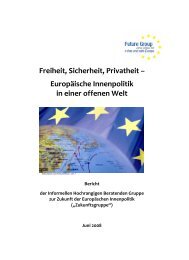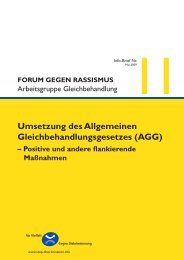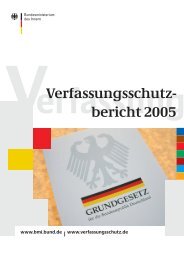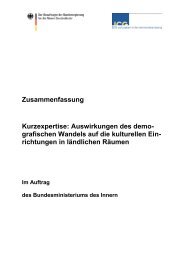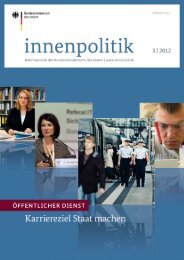TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>TB</strong><br />
43,1<br />
76<br />
FÜR UNS FÜHRT KEIN WEG ZURÜCK – MUSTER-ARTIKEL LAHN-<br />
DILL – BS 25<br />
„Für uns führt keinWeg zurück“<br />
Die Familie Leichner will als Deutsche in Deutschland leben<br />
Von Klaus Birk<br />
(0 64 71) 93 80 24<br />
k.birk@mittelhessen.de<br />
Mengerskirchen-Waldernbach. Am 25. Mai 1992 sind Ludwig und Pauline Leichner in Deutschland angekommen. Aus Kasachstan hat sie ihr Weg<br />
über das Aufnahmelager Empfingen bei Stuttgart direkt in den Westerwald nach Waldernbach geführt. Das Ehepaar Leichner hat zwei Kinder,<br />
Waldemar und Alexander, damals, als sie hier ankommen, sind die Buben 17 und 15 Jahre alt. Die Leichners wollen nicht länger als Deutsche in<br />
Russland leben. Sie wollen da leben, wo ihre Vorfahren herkamen. Aber sie kommen nicht in ihrem Vaterland an; sie kommen an in Deutschland. In<br />
einem Land, in dem sie nicht als Landsleute empfangen werden: Jetzt plötzlich sind sie Russen.<br />
Ludwig und Pauline Leichner sind nicht<br />
unbedingt eine durchschnittliche russische<br />
Familie mit deutschem Stammbaum: Beide<br />
haben die Universität besucht, beide haben<br />
hervorragende Abschlüsse. Pauline, geborene<br />
Meissner, ist Deutschlehrerin. Ludwig ist<br />
zum Generaldirektor einer staatlichen Handelskette<br />
aufgestiegen.<br />
„Wir hatten ein gutes Leben in Kasachstan.<br />
Wir hatten, was wir brauchten. Es ging uns<br />
gut“, sagt Ludwig Leichner. Sie haben viel<br />
aufgegeben.<br />
Als sie gingen, da hoffte Ludwig Leichner,<br />
dass er Glück haben und vielleicht in einem<br />
deutschen Geschäft würde Arbeit finden<br />
können; sozusagen vom Chef zum Angestellten.<br />
Trotzdem: „Wir wollten das so“,<br />
sagt er. Und wenn sie und ihre Vorfahren<br />
etwas gelernt haben in Russland, dann dies:<br />
Bei Null anzufangen.<br />
Ludwig Leichner erzählt. Er kann gut erzählen<br />
– und viel. Er erzählt zum Beispiel davon,<br />
wie sie in Kasachstan gefeiert haben.<br />
Und wie es auf ihn und „unsere Leute“<br />
wirkt, wie in Deutschland gefeiert wird. „In<br />
unserem Dorf haben alle für das Dorf gearbeitet.<br />
In der Landwirtschaft, als Lastwagenfahrer,<br />
in den Betrieben, in den Geschäften.<br />
Im Frühjahr, wenn die Felder bestellt und die<br />
Saat ausgebracht war, dann haben sich alle<br />
getroffen, zusammen gesessen, gegessen,<br />
getrunken, geredet. Es wurde ein Schwein<br />
oder ein Rind geschlachtet, es wurden Prämien<br />
verteilt. Und im Herbst, nach der Ernte,<br />
wieder.“ Es war: Gemeinsamkeit.<br />
In Deutschland wird auch gefeiert, Kirmes<br />
zum Beispiel. „Da sitzt du am Tisch und<br />
weißt nicht, worüber du mit deinem Gegenüber<br />
sprechen sollst, wenn es nicht zufällig<br />
ein Arbeitskollege oder Bekannter ist.“ Es<br />
fehlt: Gemeinsamkeit.<br />
Es schimmert Wehmut durch zwischen den<br />
Worten, „Nostalgie“, wie Ludwig Leichner<br />
es nennt; wir würden Heimweh dazu sagen.<br />
„Nostalgie hat jeder, der aus Russland nach<br />
Deutschland gekommen ist. Wer das Gegenteil<br />
behauptet, lügt“, sagt er. Und fügt hinzu:<br />
„Aber was ist denn, wenn du zurückkehrst:<br />
Was willst du dann dort?“ Für ihn steht fest:<br />
„Es gibt keinen Weg zurück.“ So wie für<br />
kaum jemanden, der den Schritt gewagt hat<br />
in das Land seiner „Urväter“, wie Leichner<br />
Deutschland nennt. Dabei kennt die Familie<br />
ihre Urväter gar nicht. Wann die Familien<br />
von Deutschland nach Russland kamen?<br />
„Wir wissen es nicht.“ Vielleicht, als Katharina<br />
die Große Mitte des 18. Jahrhunderts<br />
Deutsche Handwerker rief? Vielleicht<br />
sogar früher, vielleicht auch später. Sicher<br />
ist (Ludwig Leichner hat inzwischen die<br />
Dokumente aus geheimen Archiven): Sein<br />
Großvater wurde am 23. März 1938 zum<br />
Tode verurteilt, knapp vier Wochen später<br />
erschossen. Weil er ein Konterrevolutionär<br />
gewesen sei; vor allem aber wohl, weil er<br />
Deutscher war. Am 1. März 1960 wurde er<br />
rehabilitiert.<br />
■ Mit dem Zweiten Weltkrieg beginnt<br />
die Odyssee durch Russland<br />
Ludwig Leichners Vater, er hieß auch Ludwig<br />
und wurde 1904 im Raum Saratov in<br />
der Wolgadeutschen Republik geboren, wird<br />
1941 mit seiner Familie zwangsdeportiert –<br />
weit in den russischen Osten in die Gegend<br />
um Krasnojarsk. Es ist Krieg, Hitler hat Russland<br />
überfallen, Stalin lässt die Deutschen,<br />
die in Russland leben, verschleppen, verfolgen,<br />
umbringen. Ludwig Senior verliert alles,<br />
was er besaß. In der Verbannung sterben<br />
zudem seine erste Frau und sein Vater.<br />
1946 wird Ludwig Senior dann zurück nach<br />
Solikamsk, die Salzstadt im Ural, verwiesen.<br />
Dort, an der Perm, fängt er wieder bei<br />
Null an, dort heiratet er später seine zweite<br />
Frau Maria, dort wird am 28. Dezember<br />
1949 Sohn Ludwig geboren.<br />
1962 siedelt die Familie erneut um in die<br />
Gegend von Koktschetau im nördlichen<br />
Kasachstan. Ludwig Junior besucht dort<br />
zunächst das Technikum, später die Universität.<br />
Er wird das, was wir heute Betriebswirt<br />
nennen. Er fängt in der staatlichen Handelskette<br />
an, steigt auf zum Bezirksleiter, heiratet<br />
1973 seine Frau Pauline Meissner, deren<br />
Familie ein ganz ähnliches Schicksal zu erleiden<br />
hatte. Ihr Vater war Bauer in der Gegend<br />
von Saratow, ihre Familie wurde 1941<br />
in die Region Koktschetau deportiert.<br />
1977 ziehen Ludwig und Pauline zusammen<br />
mit ihren Söhnen Waldemar und Alexander<br />
aus dem Dorf in die Stadt, nach Koktschetau.<br />
Er wird dort Chef der Handelskette,<br />
sie unterrichtet Deutsch an einer Schule.<br />
1991 trifft Ludwig Leichner unter anderem<br />
Michail Gorbatschow und dessen verstorbene<br />
Frau Raissa, die seine Handelszentrale<br />
besuchen.<br />
„Wir haben dort nicht schlecht gelebt“, sagt<br />
Ludwig Leichner im Rückblick noch einmal.<br />
Eine schöne Wohnung hatten sie, einen<br />
gefüllten Kühlschrank, ein Auto, eine Datsche.<br />
Alles.<br />
„Aber wir waren trotzdem Fremde in diesem<br />
Land. Weil wir Deutsche waren.“ Und Ludwig,<br />
später selbst Mitglied im Prüfungsausschuss<br />
am Technikum, denkt an die Zukunft<br />
seiner Kinder: Als Deutsche würden auch<br />
sie es immer schwer haben in Russland. Und<br />
Kasachstan will in den 90er Jahren Kasachisch<br />
als Amtssprache einführen. Er ist zu<br />
diesem Zeitpunkt über 40 Jahre alt, er kann<br />
diese Sprache nicht; es würde ihm schwer<br />
fallen, Kasachisch zu lernen.<br />
Als die Einreiseerlaubnis nach Deutschland<br />
gekommen sei, da hätten sie schlecht<br />
geschlafen, er und seine Frau. Was ist richtig?<br />
Was ist falsch? Viel geredet hätten sie,<br />
nachgedacht – und dann, im Mai 1992, sind<br />
sie doch gegangen. In Waldernbach bekommen<br />
sie eine Notunterkunft zugewiesen,<br />
fast ein Jahr wohnt die Familie dort. „Wir<br />
hatten Glück, dass wir nach Waldernbach<br />
gekommen sind. Wir sind dort sehr gut aufgenommen<br />
worden“, sagt Ludwig Leichner<br />
im Rückblick.<br />
Auf den Sprachkurs muss Ludwig bis zum<br />
Herbst warten. Sie machen unliebsame Erfahrungen<br />
mit der deutschen Bürokratie und<br />
Ludwig Leichner ärgert sich, dass er nicht<br />
die Sprachkenntnisse seiner Frau hat, um auf<br />
seine Ansprüche pochen zu können.<br />
Der älteste Sohn Waldemar, der bereits am<br />
Technikum in seiner Heimatstadt seinen Abschluss<br />
als Bürokaufmann gemacht hat, und<br />
in die Fußstapfen seines Vaters treten will,<br />
hat hier keine Chance auf eine Banklehre;<br />
mangelnde Sprachkenntnisse stehen dem im<br />
Weg. Trotzdem beginnt er gleich zu arbeiten.<br />
Nach einem Jahr fängt eine Schreinerlehre<br />
in Mengerskirchen an, findet danach Arbeit<br />
bei Beck und Heun, beginnt dort eine weitere<br />
Lehre als Industriekaufmann, die er inzwischen<br />
abgeschlossen hat. Er ist von dem<br />
Waldernbacher Unternehmen übernommen<br />
worden. Alexander, der jüngere Sohn, lernt<br />
Feinblechkonstrukteur und ist inzwischen<br />
Projektleiter in einem Metallbetrieb.<br />
Auch Ludwig Leichner bekommt bald einen<br />
Job bei Beck und Heun, allerdings, sagt er,<br />
„nicht als Generaldirektor, denn den hatten<br />
sie da schon“. Er ist dort seit etlichen Jahren<br />
als Arbeiter beschäftigt. „Wie gesagt, wir<br />
sind es gewohnt, bei Null anzufangen. Mein<br />
Vater war Arbeiter und ich habe auch keine<br />
Angst vor Arbeit.“<br />
Stolz ist er auf das, was er sich in Waldernbach<br />
inzwischen geschaffen hat: Zunächst<br />
hat er eine neue Wohnung für seine Familie<br />
gefunden, dann eine für seine Schwiegereltern,<br />
die 1995 ebenfalls nach Deutschland<br />
kommen. Und schließlich hat er zusammen<br />
mit seinem Sohn ein Haus gebaut in Waldernbach,<br />
in dem sie jetzt wohnen.<br />
In Kasachstan ist Kasachisch übrigens bis<br />
heute keine Amtssprache geworden; es wird<br />
weiter Russisch gesprochen. Ludwig Leichner<br />
hätte seinen Direktorenposten behalten,<br />
dort in Rente gehen und mit seiner Familie<br />
weiter leben können. Aber, sagt er: „ Wir<br />
wollten als Deutsche in Deutschland leben.<br />
Und zurückkehren? Was soll ich denn in Kasachstan?“<br />
Hier in Deutschland sehen er und<br />
seine Familie die Zukunft.<br />
Quelle: Zeitungsgruppe lahndill „Deutsche<br />
aus Russland – Russen in Deutschland“<br />
v. 22. Mai 2006, Seite 11