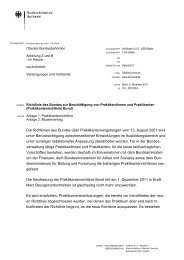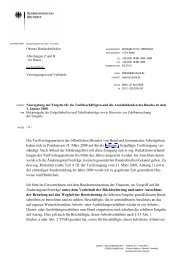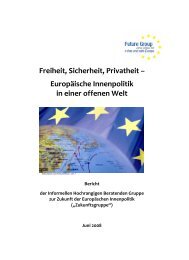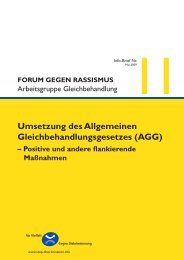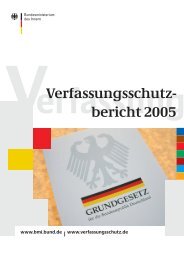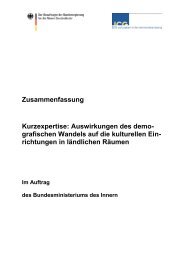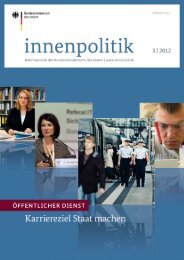TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
TB 1 - Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
NEULANDERSCHLIEßUNG – DIE ZEIT –<br />
UNSERE LANDSLEUTE AUS KARAGANDA – BS 17,22<br />
hat sie im Stich gelassen, sie lernten Russisch,<br />
Kasachisch.“ Auf der Gangway ist ihnen zumute,<br />
als flögen sie ins All: „Karaganda–Frankfurt,<br />
Karaganda–Kosmos.“<br />
Ursachen und Verlauf des Exodus werden künftige<br />
Historiker erforschen; für Karaganda ist vorläufig<br />
Folgendes festzuhalten: Am 30. September 1973<br />
trafen sich etwa 400 Deutsche zu einer verbotenen<br />
Demonstration. Verhaftungen folgten. Ganze Familien,<br />
Sowjetfeinde meist aus Glaubensgründen,<br />
setzten sich nach Moldawien oder ins Baltikum ab,<br />
wo Ausreiseanträge größere Erfolgschancen hatten.<br />
Nach Jahren des Wartens durften viele nach<br />
Germanija ziehen – eine Vorhut.<br />
Ähnlich mutige Leute waren es, solche wie die<br />
Dycks und die Pauls, die sofort das Passgesetz von<br />
1986 zu nutzen versuchten. Wenig später schon<br />
war die Entwicklung nicht mehr aufzuhalten. Zum<br />
einen kam mit dem freien Sprechen, das nun möglich<br />
war, die Vergangenheit ans Licht, Deportation,<br />
Zwangsarbeit, der ganze Albtraum der Geschichte.<br />
Und die ebenso tabuisierte, gefährliche Lage der<br />
Stadt: Karaganda befindet sich zwischen Semipalatinsk<br />
(Atomwaffentests), Baikonur (Kosmodrom)<br />
und Stepnogorsk (Biowaffen). Zugleich kündigte<br />
sich ein gesellschaftliches Beben an. Die Kasachen<br />
forderten ihr Recht, der Koloss Sowjetunion schien<br />
ins Wanken geraten. Es war mehr ein Gefühl als<br />
ein klares Bewusstsein: Raus, bevor wieder etwas<br />
Schreckliches passiert! Einmal in Gang, entstand<br />
so etwas wie eine Kettenreaktion.<br />
1989 war Karaganda mit seinen 800.000 Einwohnern<br />
noch eine moderne Großstadt sowjetischen<br />
Typs. 1991 stürzte sie mit dem Reich ins Bodenlose,<br />
ihr Niedergang war fast so dramatisch wie<br />
ihr Aufstieg 70 Jahre zuvor. 36 Schächte wurden<br />
geschlossen, die Kohle, um derentwillen Karaganda<br />
gegründet wurde, brauchte keiner mehr. Wer<br />
nur eben konnte, Russen, Polen, Ukrainer et cetera<br />
floh in die alte Heimat. Heizungsleitungen platzten<br />
im Winter, der Strom fiel aus, leere Wohnblocks<br />
zerfielen wie im Zeitraffer. „Die Steppe“, sagten<br />
die Zurückbleibenden, „erobert die Stadt zurück.“<br />
So war es, als Familie Gudi und die Hensels sie<br />
verließen.<br />
Mitte der Neunziger trat der Exodus in seine vorerst<br />
letzte Phase ein. Indem die Bundesregierung den<br />
Zuzug auf 100.000 Aussiedler pro Jahr begrenzte<br />
und Sprachtests einführte, entstanden Wartezeiten<br />
von drei bis sieben Jahren. Derweil stabilisierte<br />
sich die Situation Karagandas ein wenig. Nach<br />
Plan von Präsident Nasarbajew, den russisch kolonisierten<br />
Norden kasachisch zu prägen, wurde<br />
eine neue Hauptstadt geschaffen, Astana. Man<br />
legte Siedlungsprogramme auf, aus den Kolchosen<br />
freigesetzte Kasachen zogen in die Städte des<br />
Nordens, desgleichen Exilkasachen aus der Mongolei.<br />
In Karaganda leben inzwischen 45 Prozent<br />
Kasachen, früher waren es drei Prozent. Das Volk<br />
der Nomaden und Halbnomaden, das nach 1917<br />
in die Moderne katapultiert wurde und wie kaum<br />
ein anderes seine Identität verloren hat, seine Tradition,<br />
seine Sprache, den muslimischen Glauben,<br />
will die Tragödie mit Macht überwinden. Und in<br />
dieser Neuordnung haben, auch wenn sie sich bemerkenswert<br />
friedlich vollzieht, die auf Ausreise<br />
Wartenden keinen Platz.<br />
Solche wie Familie Onodalo aus Abai, einem Sputnik<br />
von Karaganda. Soeben, nach fünf zähen<br />
Jahren des Wartens, aus 27 Grad minus in den<br />
Vorfrühling geraten, nach Friedland. „I-ch biiin<br />
An-gst“, buchstabiert Ida Onodalo und zieht die<br />
Stirn unter den braunen Locken kraus. Ihr Mann<br />
Alexander und der erwachsene Sohn haben Reißaus<br />
genommen, wir sind zu zweit in dem weiß<br />
getünchten Schlafsaal. „Ich kann nich verzelle, o<br />
gospodi! (Mein Gott!)“. Sie scheint einer Ohnmacht<br />
nahe.<br />
Hinter ihr liegen Wochen des Abschieds, vom älteren<br />
Sohn und von dessen Familie, von ihrer besten<br />
Freundin Sagat, einer Kasachin, von ihren Schülern.<br />
Eine Lehrerin, die auf einmal sprachlos ist. Sie, Ida,<br />
die Tochter von Wolgadeutschen, wird von jetzt<br />
an ihren Mann, den Ukrainer, stützen müssen, der<br />
es noch schwerer hat. Seine ganze große Familie<br />
blieb in der Steppe zurück, seine Kultur hat in<br />
Deutschland so gut wie keine Überlebenschance.<br />
Quelle: DIE ZEIT 11.03.2004 Nr.12 http://www.zeit.<br />
de/2004/12/Russlanddeutsche<br />
<strong>TB</strong><br />
34,4<br />
51