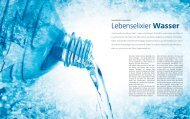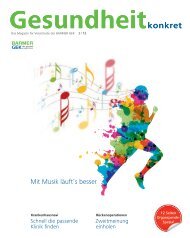ICHbinICH und DUbistDU
ICHbinICH und DUbistDU
ICHbinICH und DUbistDU
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
56<br />
57<br />
Quatschen mit Soße<br />
Eltern fragen sich nicht, wie sie mit ihrem Kind sprechen sollen – sie tun es einfach.<br />
Sie säuseln <strong>und</strong> singen, scherzen<br />
<strong>und</strong> trösten, erklären ihm die Welt<br />
<strong>und</strong> schimpfen auch mal. Sie führen<br />
mit ihrem Kind diese w<strong>und</strong>ervolle<br />
Unterhaltung, wie nur Eltern das<br />
können. Mütter <strong>und</strong> Väter lieben ihr<br />
Kind eben <strong>und</strong> lassen es dies auch<br />
in ihren Worten spüren.<br />
So erfahren Eltern, was ihr Kind<br />
denkt, fühlt <strong>und</strong> was es sich wünscht,<br />
<strong>und</strong> sie teilen sich ihrem Kind auch<br />
selbst mit. Auf diese Weise lernt es,<br />
das Leben zu be greifen. Dabei sind<br />
Eltern ihrem Kind ein Wegweiser am<br />
Tag, wenn die Neugier es zu freudigen<br />
Ent deckungen leitet, <strong>und</strong> ein<br />
Leuchtturm in der Nacht, wenn es<br />
in bösen Träumen auf dunkle Pfade<br />
gerät.<br />
Das alles soll auch so sein. Denn<br />
diese intuitive „sprechende“ Zuwendung<br />
vertieft die Bindung zwischen<br />
Ihnen <strong>und</strong> Ihrem Kind <strong>und</strong><br />
lehrt es „ganz nebenbei“ auch das<br />
Denken. Sprechen <strong>und</strong> Denken<br />
gehören nämlich untrennbar zusammen,<br />
das wusste schon der Wissenschaftler<br />
Alexander von Humboldt<br />
vor 200 Jahren. Die Sprache gibt<br />
den Dingen nämlich nicht nur eine<br />
Bezeichnung, sondern auch eine<br />
emotionale Bedeutung. So lernt das<br />
Kind zum Beispiel, dass das r<strong>und</strong>e<br />
bunte Etwas „Ball“ heißt – <strong>und</strong> dass<br />
„Ball spielen“ Vergnügen bereitet.<br />
Besonders mit „Mama“ oder „Papa“.<br />
Jetzt kann das Kind einen Gedanken<br />
fassen, einen Plan entwickeln, ihn<br />
äußern <strong>und</strong> umsetzen: „Papa,<br />
Ba', pielen!“ Auch auf diese Weise<br />
erobert es die Welt.<br />
Gerade heraus<br />
Der Kommunikationswissenschaftler<br />
Paul Watzlawick zeigt in seinem<br />
Buch „Anleitung zum Unglücklichsein“<br />
1 mit viel Humor, wie sich<br />
Menschen im Alltag gründlich missverstehen<br />
können. Denn hinter manchem<br />
Satz verbirgt sich viel mehr,<br />
als wir ahnen. Das ist auch zwischen<br />
Eltern <strong>und</strong> Kindern nicht anders.<br />
Ein Beispiel: „Dein Zimmer ist aber<br />
unordentlich“, sagt eine Mutter zu<br />
ihrer vierjährigen Tochter. „Ja“,<br />
gibt die Tochter zurück <strong>und</strong> spielt<br />
seelenruhig weiter. Da schimpft<br />
die Mutter: „Sei nicht so frech!“ –<br />
<strong>und</strong> erntet einen beleidigten Blick.<br />
Was ist hier schiefgelaufen? Wahrscheinlich<br />
wollte die Mutter nur<br />
sagen: „Räum dein Zimmer auf!“.<br />
Hat sie aber nicht gesagt. Daran wird<br />
klar: Wer nicht sagt, was er meint,<br />
programmiert Missverständnisse <strong>und</strong><br />
Ärger voraus. Kinder in diesem Alter<br />
können übrigens „Zwischentöne“<br />
(noch) gar nicht interpretieren, sie<br />
nehmen alles wörtlich. Eltern hingegen<br />
geht Doppeldeutiges schon<br />
mal über die Zunge. Schade!<br />
Dabei wäre es doch so einfach: Soll<br />
das Kind sein Zimmer aufräumen,<br />
dann sagen wir ihm das fre<strong>und</strong>lich<br />
<strong>und</strong> klar. Sollte das Kind noch zu<br />
klein sein, um das Chaos im Zimmer<br />
allein zu beseitigen, können wir ihm<br />
unsere Hilfe anbieten. Quillt der<br />
Raum aber vor Spielsachen so über,<br />
dass Ordnung machen kaum mehr<br />
möglich ist, dann müssen Eltern <strong>und</strong><br />
Kind halt gemeinsam ein bisschen<br />
aussortieren. Das wirkt oft W<strong>und</strong>er!<br />
Miteinander reden<br />
Es kommt also nicht nur darauf an,<br />
dass Eltern viel mit ihrem Kind sprechen,<br />
sondern auch, wie sie es tun.<br />
Hier beherrschen die meisten Eltern<br />
intuitiv die wichtigsten Regeln:<br />
■ Sie blicken das Kind beim Sprechen<br />
an <strong>und</strong> gehen in entscheidenden<br />
Momenten mit dem Kind auf<br />
Augenhöhe.<br />
■ Sie sprechen mit dem Kind<br />
darüber, was es gerade erlebt,<br />
hören ihm gut zu <strong>und</strong> unterbrechen<br />
es nicht.<br />
■ Sie äußern stets klar ihre Erwartung<br />
<strong>und</strong> sind nicht ironisch,<br />
abwertend oder doppeldeutig.<br />
■ Sie ermutigen das Kind, loben<br />
es aber nicht ständig über den<br />
grünen Klee.<br />
1<br />
Watzlawick, P.: Anleitung zum Unglücklichsein,<br />
Piper Verlag 1983.<br />
■ Sie erzählen dem Kind auch von<br />
sich <strong>und</strong> begleiten ihre Handlungen<br />
mit Sprache, überfordern das Kind<br />
aber nicht mit langschweifigen<br />
Erklärungen.<br />
■ Sie verbessern <strong>und</strong> „trainieren“ ihr<br />
Kind nicht, indem sie etwas nachsprechen<br />
lassen oder es „abfragen“<br />
<strong>und</strong> führen seine Sprachkünste<br />
auch niemandem vor.<br />
■ Sie benutzen keine Babysprache,<br />
sondern bestätigen das Gehörte<br />
nur korrekt („Papa, Ba'!“ – „Oh ja,<br />
da liegt ein Ball!“).<br />
■ Sie erteilen Verbote sparsam, aber<br />
eindeutig, <strong>und</strong> zeigen möglichst<br />
eine Handlungsalternative auf.<br />
■ Sie entschuldigen sich beim Kind<br />
ernsthaft, wenn sie mal einen<br />
falschen Ton angeschlagen haben.<br />
Das Zauberwort<br />
Ein kurzes Wort zum berühmten<br />
Zauberwort „Bitte“. Natürlich ist es<br />
gut, sein Kind auch zur Höflichkeit<br />
zu erziehen <strong>und</strong> selbst fre<strong>und</strong>lich mit<br />
ihm zu sprechen. Allerdings sollten<br />
sich Eltern davor hüten, beflissen in<br />
einen angesagten pädagogischen<br />
Jargon zu verfallen, rät der erfahrene<br />
Pädagoge <strong>und</strong> Erziehungsberater<br />
Prof. Dr. Heinrich Kupffer: „Viele<br />
Löwenstark<br />
Ein <strong>ICHbinICH</strong> kennt einen<br />
mit ellenlangen Beinen.<br />
Und auch noch einen zweiten,<br />
der kann auf Stühlen reiten.<br />
Zu dritt ist diese Bande<br />
zu jedem Quatsch imstande.<br />
Das nervt zwar manchmal voll,<br />
ist tatsächlich aber toll.<br />
Denn Fre<strong>und</strong>e machen löwenstark,<br />
<strong>und</strong> das ist ganz bestimmt kein Quark!<br />
Eltern haben gelernt, dass man<br />
‚Bitte‘ sagen muss, wenn man etwas<br />
vom Kind will. ‚Bitte matsch nicht<br />
so mit dem Essen!‘ – ‚Bitte nimm die<br />
Füße vom Stuhl!‘ – ‚Bitte lauf nicht<br />
auf die Straße!‘ – ‚Bitte zieh nicht an<br />
meinen Haaren!‘ – ‚Bitte hau deinen<br />
Bruder nicht ständig!‘ Solche Sätze<br />
hören wir überall. Aber statt die<br />
Bitte zu erfüllen, stellt sich das Kind<br />
taub. Daraufhin wird der Tonfall<br />
strenger, bis das ‚BITTE‘ Kasernenhoflautstärke<br />
erreicht. Das Kind weiß<br />
jedoch, dass das Zauberwort in diesen<br />
Fällen keine echte Bitte ist. Denn<br />
die könnte man auch ausschlagen.<br />
Vielmehr soll das kleine Wörtchen<br />
hier nur verschleiern, dass es sich<br />
tatsächlich um eine Anweisung handelt.“<br />
Für Eltern folgt daraus: Wer<br />
seinem Kind eine Anweisung gibt,<br />
sollte nicht so tun, als wäre es keine.<br />
Verständigung