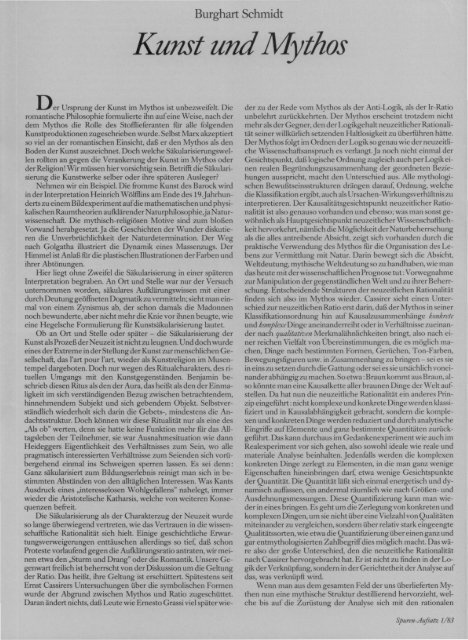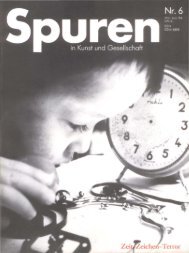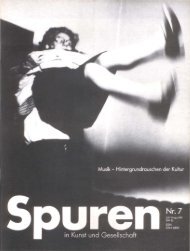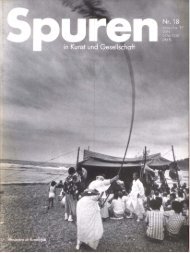utzräUmen ·~ - Hochschule für bildende Künste Hamburg
utzräUmen ·~ - Hochschule für bildende Künste Hamburg
utzräUmen ·~ - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Burghart Schmidt<br />
Kunst und Mythos<br />
D er Ursprung der Kunst im Mythos ist unbezweifelt. Die<br />
romantische Philosophie formulierte ihn auf eine Weise, nach der<br />
dem Mythos die Rolle des Stoffiieferanten fiir alle folgenden<br />
Kunstproduktionen zugeschrieben wurde. Selbst Marx akzeptiert<br />
so viel an der romantischen Einsicht, daß er den Mythos als den<br />
Boden der Kunst auszeichnet. Doch welche Säkularisierungswellen<br />
rollten an gegen die Verankerung der Kunst im Mythos oder<br />
der Religion! Wir müssen hier vorsichtig sein. Betrifft die Säkularisierung<br />
die Kunstwerke selber oder ihre späteren Ausleger?<br />
Nehmen wir ein Beispiel. Die fromme Kunst des Barock wird<br />
in der Interpretation Heinrich Wölffiins am Ende des 19.Jahrhunderts<br />
zu einem Bildexperiment auf die mathematischen und physikalischen<br />
Raumtheorien aufklärender Naturphilosophie,ja Naturwissenschaft.<br />
Die mythisch-religiösen Motive sind zum bloßen<br />
Vorwand herabgesetzt. Ja die Geschichten der Wunder diskutieren<br />
die Unverbrüchlichkeit der Naturdetermination. Der Weg<br />
nach Golgatha illustriert die Dynamik eines Massenzugs. Der<br />
Himmel ist Anlaß fiir die plastischen Illustrationen der Farben und<br />
ihrer Abtönungen.<br />
Hier liegt ohne Zweifel die Säkularisierung in einer späteren<br />
Interpretation begraLen. An Ort und Stelle war nur der Versuch<br />
unternommen worden, säkulares Aufklärungswissen mit einer<br />
durch Deutung geöffueten Dogmatik zu vermitteln; sieht man einmal<br />
von einem Zynismus ab, der schon damals die Madonnen<br />
noch bewunderte, aber nicht mehr die Knie vor ihnen beugte, wie<br />
eine Hegeische Formulierung fiir Kunstsäkularisierung lautet.<br />
Ob an Ort und Stelle oder später - die Säkularisierung der<br />
Kunst als Prozeß der Neuzeit ist nicht zu leugnen. Und doch wurde<br />
eines der Extreme in der Stellung der Kunst zur menschlichen Gesellschaft,<br />
das l'art pour l'art, wieder als Kunstreligion im Musentempel<br />
dargeboten. Doch nur wegen des Ritualcharakters, des rituellen<br />
Umgangs mit den Kunstgegenständen. Benjamin beschrieb<br />
diesen Ritus als den der Aura, das heißt als den der Einmaligkeit<br />
im sich verständigenden Bezug zwischen betrachtendem,<br />
hinnehmendem Subjekt und sich gebendem Objekt. Selbstverständlich<br />
wiederholt sich darin die Gebets-, mindestens die Andachtsstruktur.<br />
Doch können wir diese Ritualität nur als eine des<br />
"Als ob" werten, denn sie hatte keine Funktion mehr fiir das Alltagsleben<br />
der Teilnehmer, sie war Ausnahmesituation wie dann<br />
Heideggers Eigentlichkeit des Verhältnisses zum Sein, wo alle<br />
pragmatisch interessierten Verhältnisse zum Seienden sich vorübergehend<br />
einmal ins Schweigen sperren lassen. Es sei denn:<br />
Ganz säkularisiert zum Bildungserlebnis reinigt man sich in bestimmten<br />
Abständen von den alltäglichen Interessen. Was Kants<br />
Ausdruck eines "interesselosen Wohlgefallens" nahelegt, immer<br />
wieder die Aristotelische Katharsis, welche von weiteren Konsequenzen<br />
befreit.<br />
Die Säkularisierung als der Charakterzug der Neuzeit wurde<br />
so lange überwiegend vertreten, wie das Vertrauen in die wissenschaftliche<br />
Rationalität sich hielt. Einige geschichtliche Erwartungsverweigerungen<br />
enttäuschen allerdings so tief, daß schon<br />
Proteste vorlaufend gegen die Aufklärungsratio antraten, wir meinen<br />
etwa den "Sturm und Drang" oder die Romantik. Unsere Gegenwart<br />
freilich ist beherrscht von der Diskussion um die Geltung<br />
der Ratio. Das heißt, ihre Geltung ist erschüttert. Spätestens seit<br />
Ernst Cassirers Untersuchungen über die symbolischen Formen<br />
wurde der Abgrund zwischen Mythos und Ratio zugeschüttet.<br />
Daran ändert nichts, daß Leute wie Ernesto Grassi viel später wieder<br />
zu der Rede vom Mythos als der Anti-Logik, als der Ir-Ratio<br />
unbelehrt zurückkehrten. Der Mythos erscheint trotzdem nicht<br />
mehr als der Gegner, den der Logikgehalt neuzeitlicher Rationalität<br />
seiner willkürlich setzenden Haltlosigkeit zu überfuhren hätte.<br />
Der Mythos folgt im Ordnen der Logik so genau wie der neuzeitliche<br />
Wissenschaftsanspruch es verlangt. Ja noch nicht einmal der<br />
Gesichtspunkt, daß logische Ordnung zugleich auch per Logik einen<br />
realen Begründungszusammenhang der geordneten Beziehungen<br />
ausspricht, macht den Unterschied aus. Alle mythologischen<br />
Bewußtseinsstrukturen drängen darauf, Ordnung, welche<br />
die Klassifikation ergibt, auch als Ursachen-Wirkungsverhältnis zu<br />
interpretieren. Der Kausalitätsgesichtspunkt neuzeitlicher Rationalität<br />
ist also genauso vorhanden und ebenso; was man sonst gewöhnlich<br />
als Hauptgesichtspunkt neuzeitlicher Wissenschaftlichkeit<br />
hervorkehrt, nämlich die Möglichkeit der Naturbeherrschung<br />
als die alles antreibende Absicht, zeigt sich vorhanden durch die<br />
praktische Verwendung des Mythos fiir die Organisation des Lebens<br />
zur Vermittlung mit Natur. Darin bewegt sich die Absicht,<br />
Weltdeutung, mythische Weltdeutung so zu handhaben, wie man<br />
das heute mit derwissenschaftlichen Prognose tut: Vorwegnahme<br />
zur Manipulation der gegenständlichen Welt und zu ihrer Beherrschung.<br />
Entscheidende Strukturen der neuzeitlichen Rationalität<br />
finden sich also im Mythos wieder. Cassirer sieht einen Unterschied<br />
zur neuzeitlichen Ratio erst darin, daß der Mythos in seiner<br />
Klassifikationsordnung hin auf Kausalzusammenhänge konkrete<br />
und komplexe Dinge aneinanderreiht oder in Verhältnisse zueinander<br />
nach quaktativen M~;kmalähnlichkeiten bringt, also nach einer<br />
reichen Vielfalt von Ubereinstimmungen, die es möglich machen,<br />
Dinge nach bestimmten Formen, Gerüchen, Ton-Farben,<br />
Bewegungsfiguren usw. in Zusammenhang zu bringen- sei es sie<br />
in eins zu setzen durch die Gattung oder sei es sie ursächlich voneinander<br />
abhängig zu machen. So etwa: Braun kommt aus Braun, also<br />
könnte man eine Kausalkette aller braunen Dinge der Welt aufstellen.<br />
Da hat nun die neuzeitliche Rationalität ein anderes Prinzip<br />
eingefiihrt: nicht komplexe und konkrete Dinge werden klassifiziert<br />
und in Kausalabhängigkeit gebracht, sondern die komplexen<br />
und konkreten Dinge werden reduziert und durch analytische<br />
Eingriffe aufElemente und ganz bestimmte Quantitäten zurückgefiihrt.<br />
Das kann durchaus im Gedankenexperiment wie auch im<br />
Realexperiment vor sich gehen, also sowohl ideale wie reale und<br />
materiale Analyse beinhalten. Jedenfalls werden die komplexen<br />
konkreten Dinge zerlegt zu Elementen, in die man ganz wenige<br />
Eigenschaften hineinbringen darf, etwa wenige Gesichtspunkte<br />
der Quantität. Die Quantität läßt sich einmal energetisch und dynamisch<br />
auffassen, ein andermal räumlich wie nach Größen- und<br />
Ausdehnungsmessungen. Diese Quantifizierung kann man wieder<br />
in eines bringen. Es geht um die Zerlegung von konkreten und<br />
komplexen Dingen, um sie nicht über eine Vielzahl von Qualitäten<br />
miteinander zu vergleichen, sondern über relativ stark eingeengte<br />
Qualitätssorten, wie etwa die Quantifizierung über einen ganz und<br />
gar entmythologisierten Zahlbegriff dies möglich macht. Das wäre<br />
also der große Unterschied, den die neuzeitliche Rationalität<br />
nach Cassirer hervorgebracht hat. Er ist nicht zu fmden in der Logik<br />
der Verknüpfung, sondern in der Gerichtetheit der Analyse auf<br />
das, was verknüpft wird.<br />
Wenn man aus dem gesamten Feld der uns überlieferten Mythen<br />
nun eine mythische Struktur destillierend hervorzieht, welche<br />
bis auf die Zurüstung der Analyse sich mit den rationalen<br />
Spuren-Auflatz 1/83