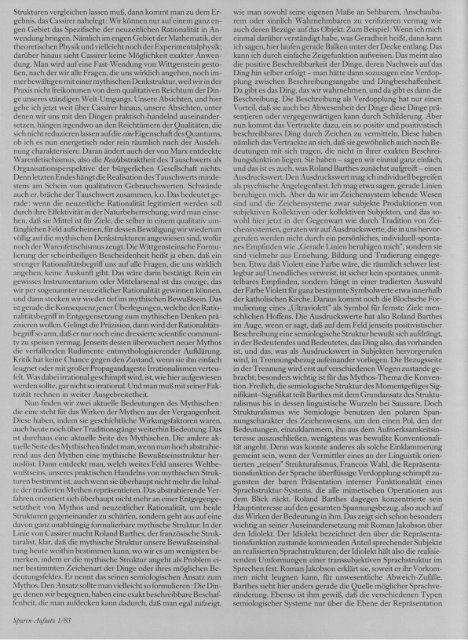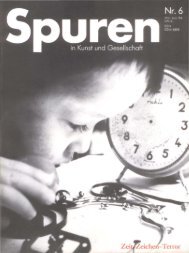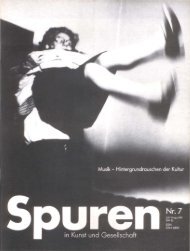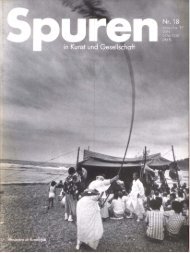utzräUmen ·~ - Hochschule für bildende Künste Hamburg
utzräUmen ·~ - Hochschule für bildende Künste Hamburg
utzräUmen ·~ - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Strukturen vergleichen lassen muß, dann kommt man zu dem Ergebnis,<br />
das Cassirer nahelegt: Wir können nur auf einem ganzengen<br />
Gebiet das Spezifische der neuzeitlichen Rationalität in Anwendung<br />
bringen. Nämlich im engen Gebiet der Mathematik, der<br />
theoretischen Physik und vielleicht noch der Experimentalphysik;<br />
darüber hinaus sieht Cassirer keine Möglichkeit exakter Anwendung.<br />
Man wird auf eine Fast-Wendung von Wittgenstein gestoßen,<br />
nach der wir alle Fragen, die uns wirklich angehen, noch immer<br />
bewältigen mit einer mythischen Denkstruktur, weil wir in der<br />
Praxis nicht freikommen von dem qualitativen Reichtum der Dinge<br />
unseres ständigen Welt-Umgangs. Unsere Absichten, und hier<br />
gehe ich jetzt weit über Cassirer hinaus, unsere Absichten, unter<br />
denen wir uns mit den Dingen praktisch-handelnd auseinandersetzen,<br />
hängen irgend wo an den Reichtümern der Qualitäten, die<br />
sich nicht reduzieren lassen auf die dne Eigenschaft des Quantums,<br />
ob ich es nun energetisch oder rein räumlich nach der Ausdehnung<br />
charakterisiere. Daran ändert auch der von Marx entdeckte<br />
Warenfetischismus, also die Rea/abstraktheit des Tauschwerts als<br />
Organisationsperspektive ·der ·bürgerlichen Gesellschaft nichts.<br />
Denn letzten Endes hängt die Realisation des Tauschwerts mindestens<br />
am Schein von qualitativen Gebrauchswerten. Schwände<br />
auch er, bräche der Tauschwert zusammen, k.o. Das bedeutet gerade:<br />
wenn die neuzeitliche Rationalität legitimiert werden soll<br />
durch ihre Effektivität in der Naturbeherrschung, wird man einsehen,<br />
daß sie Mittel ist fur Ziele, die selber in einem qualitativ umfanglichen<br />
Feld auf'icheinen, fur dessen Bewäligung wir wiederum<br />
völlig auf die mythischen Denkstrukturen angewiesen sind, wofur<br />
noch der Warenfetischismus zeugt. Die Wittgensteinsche Formulierung<br />
der scheinheiligen Bescheidenheit heißt ja eben, daß ein<br />
strenger Rationalitätsbegriff uns auf alle Fragen, die uns wirklich<br />
angehen, keine Auskunft gibt. Das wäre darin bestätigt. Rein ein<br />
gewisses Instrumentarium oder Mittelarsenal ist das einzige, das<br />
wirpersogenannter neuzeitlicher Rationalität gewinnen können,<br />
und dann stecken wir wieder tief im mythischen Bewußtsein. Das<br />
ist gerade die Konsequenz jener Überlegungen, welche den Rationalitätsbegriffin<br />
Entgegensetzung zum mythischen Denken präzisieren<br />
wollen. Gelingt die Präzision, dann wird der Rationalitätsbegriff<br />
so arm, daß er nur noch eine dressierte scientific community<br />
zu speisen vermag. jenseits dessen überwuchert neuer Mythos<br />
die verfallenden Rudimente entmythologisierender Aufklärung.<br />
Kritik hat keine Chance gegen den Zustand, wenn sie ihn einfach<br />
leugnet oder mit großer Propagandageste Irrationalismen verteufelt.<br />
Was dabei irrational geschimpft wird, ist, wie hier aufgewiesen<br />
werden sollte, gar nicht so irrational. Und man muß mit seiner Faktizität<br />
rechnen in weiter AusgebreitetheiL<br />
Nun finden wir zwei aktuelle Bedeutungen des Mythischen:<br />
die eine steht fi.ir das Wirken der Mythen aus der Vergangenheit.<br />
Diese haben, indem sie geschichtliche Wirkungsfaktoren waren,<br />
auch heute noch über Traditionsgänge weiterhin Bedeutung. Das<br />
ist durchaus eine aktuelle Seite des Mythischen. Die andere aktuelle<br />
Seite des Mythischen findet man, wenn man hoch abstrahierend<br />
aus den Mythen eine mythische Bewußtseinsstruktur herauslöst.<br />
Dann entdeckt man, welch weites Feld unseres Weltbewußtseins,<br />
unseres praktischen Handeins von mythischen Strukturen<br />
bestimmt ist, auch wenn sie überhaupt nicht mehr die Inhalte<br />
der tradierten Mythen repräsentieren. Das abstrahierende Verfahren<br />
orientiert sich überhaupt nicht mehr an einer Entgegengesetztheit<br />
von Mythos und neuzeitlicher Rationalität, um beide<br />
Strukturen gegeneinander zu schärfen, sondern geht aus auf eine<br />
davon ganz unabhängig formulierbare mythische Struktur. In der<br />
Linie von Cassirer macht Roland Barthes, der französische Stmkturalist,<br />
klar, daß die mythische Stmktur unsere Bewußtseinshaltung<br />
heute weithin bestimmen kann, wo wir es am wenigsten bemerken,<br />
indem er die mythische Struktur angeht als Problem einer<br />
bestimmten Zeichenart der Dinge oder ihres möglichen Bedeutungsfeldes.<br />
Er nennt das seinen semiologischen Ansatz zum<br />
Mythos. Den Ansatz sollte man vielleicht so formulieren: Die Dinge,<br />
denen wir begegnen, haben eine exakt beschreibbare Beschaffenheit,<br />
die man aufdecken kann dadurch, daß man egal aufzeigt,<br />
wie man sowohl seine eigenen Maße an Sehbarem, Anschaubarem<br />
oder sinnlich Wahrnehmbaren zu verifizieren vermag wie<br />
auch deren Bezüge auf das Objekt. Zum Beispiel: Wenn ich mich<br />
einmal darüber verständigt habe, was Geradheit heißt, dann kann<br />
ich sagen, hier laufen gerade Balken unter der Decke entlang. Das<br />
kann ich durch einfache Zeigefunktion aufWeisen. Das meint also<br />
die positive Beschreibbarkeit der Dinge, deren Nachweis auf das<br />
Ding hin selber erfolgt- man hätte dann sozusagen eine Verdopplung<br />
zwischen Beschreibungsangabe und Dingbeschaffenheit<br />
Da gibt es das Ding, das wir wahrnehmen, und da gibt es dann die<br />
Beschreibung. Die Beschreibung als Verdopplung hat nur einen<br />
Vorteil, daß sie auch bei Abwesenheit der Dinge diese Dinge präsentieren<br />
oder vergegenwärtigen kann durch Schilderung. Aber<br />
nun kommt das Vertrackte dazu, ein so positiv und positivistisch<br />
beschreibbares Ding durch Zeichen zu vermitteln. Diese haben<br />
nämlich das Vertrackte an sich, daß sie gewöhnlich auch noch Bedeutungen<br />
mit sich tragen, die nicht in ihrer exakten Beschreibungsfunktion<br />
liegen. Sie haben- sagen wir einmal ganz einfach,<br />
und das ist es auch, was Roland Barthes zunächst aufgreift- einen<br />
Ausdruckswert. Den Ausdruckswert mag ich individuell begreifen<br />
als psychische Angelegenheit. Ich mag etwa sagen, gerade Linien<br />
beruhigen mich. Aber da wir im Zeichensystem lebende Wesen<br />
sind und die Zeichensysteme zwar subjekte Produktionen von<br />
subjektiven Kollektiven oder kollektiven Subjekten, und äas sowohl<br />
hier jetzt in der Gegenwart wie durch Tradition von Zeichensystemen,<br />
geraten wir auf Ausdruckswerte, die in uns hervorgemfen<br />
werden nicht durch ein persönliches, individuell-spontanes<br />
Empfinden wie "Gerade Linien beruhigen mich", sondern sie<br />
sind vielmehr aus Erziehung, Bildung und Tradierung eingegeben.<br />
Etwa daß Violett eine Farbe wäre, die räumlich schwer festlegbar<br />
aufUnendliches verweist, ist sicher kein spontanes, unmittelbares<br />
Empfinden, sondern hängt in einer tradierten Auswahl<br />
der Farbe Violett fur ganz bestimmte Symbolwerte etwa innerhalb<br />
der katholischen Kirche. Daraus kommt noch die Blochsehe Formulierung<br />
eines "Ultraviolett" als Symbol fur fernste Ziele menschlichen<br />
Hoffens. Die Ausdruckswerte hat also Roland Barthes<br />
im Auge, wenn er sagt, daß auf dem Feld jenseits positivistischer<br />
Beschreibung eine semiologische Struktur bewußt sich aufdrängt,<br />
in der Bedeutendes und Bedeutetes, das Ding also, das vorhanden<br />
ist, und das, was als Ausdruckswert in Subjekten hervorgerufen<br />
wird, in Trennungsbezug aufeinander vorliegen. Die Bezugsseite<br />
in der Trennung wird erst auf verschiedenen Wegen zustande gebracht;<br />
besonders wichtig ist fur das Mythos-Thema die Konvention.<br />
Freilich, die semiologische Struktur des Momentgefuges Signifikant<br />
-Signifikat teilt Barthes mit dem Grundansatz des Strukturalismus<br />
bis in dessen linguistische Wurzeln bei Saussure. Doch<br />
Strukturalismus wie Semiologie benutzen den polaren Spannungscharakter<br />
des Zeichenwesens, um den einen Pol, den der<br />
Bedeutungen, einzuklammern, ihn aus dem Aufmerksamkeitsinteresse<br />
auszuschließen, wenigstens was bewußte Konventionalität<br />
angeht. Denn was konnte anderes als solche Einklammerung<br />
gemeint sein, wenn der Vermittler eines an der Linguistik orientierten<br />
"reinen" Strukturalismus, Franccis Wahl, die Repräsentationsfunktion<br />
der Sprache überflüssige Verdopplung schimpft zugunsten<br />
der baren Präsentation interner Funktionalität eines<br />
Sprachstruktur-Systems, die alle mimetischen Operationen aus<br />
dem Blick rückt. Roland Barthes dagegen konzentrierte sein<br />
Hauptinteresse auf den gesamten Spannungsbezug, also auch auf<br />
das Wirken der Bedeutung in ihm. Das zeigt sich schon besonders<br />
wichtig an seiner Auseinandersetzung mit Romanjakobsan über<br />
den Idiolekt. Der Idiolekt bezeichnet den über die Repräsentationsfunktion<br />
zustande kommenden Anteil sprechender Subjekte<br />
an realisierten Sprachstrukturen; der Idiolekt hält also die realisierenden<br />
Umformungen einer transsubjektiven Sprachstruktur im<br />
Sprechen fest. Romanjakobsan erklärt sie, soweit er ihr Vorkommen<br />
nicht leugnen kann, fur unwesentliche Abweich-Zufalle.<br />
Barthes sieht hier anders gerade die Quelle möglicher Sprachveränderung.<br />
Ebenso ist ihm gewiß, daß die verschiedenen Typen<br />
semiologischer Systeme nur über die Ebene der Repräsentation<br />
Spuren-AufSatz I/ 83