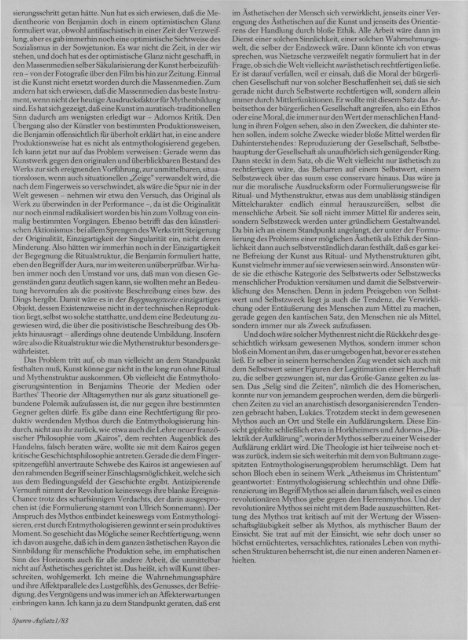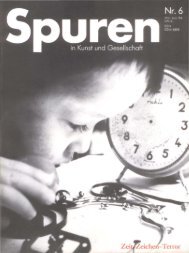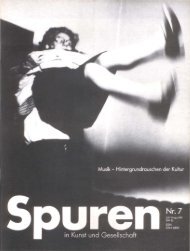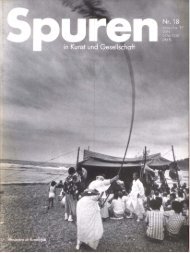utzräUmen ·~ - Hochschule für bildende Künste Hamburg
utzräUmen ·~ - Hochschule für bildende Künste Hamburg
utzräUmen ·~ - Hochschule für bildende Künste Hamburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sierungsschritt getan hätte. Nun hat es sich erwiesen, daß die Medientheorie<br />
von Benjamin doch in einem optimistischen Glanz<br />
formuliert war, obwohl antifaschistisch in einer Zeit der Verzweiflung,<br />
aber es gab immerhin noch eine optimistische Sichtweise des<br />
Sozialismus in der Sowjetunion. Es war nicht die Zeit, in der wir<br />
stehen, und doch hat es der optimistische Glanz nicht geschafft, in<br />
den Massenmedien selber Säkularisierung der Kunst herbeizufuhren-von<br />
der Fotografie über den Film bis hin zur Zeitung. Einmal<br />
ist die Kunst nicht ersetzt worden durch die Massenmedien. Zum<br />
andern hat sich erwiesen, daß die Massenmedien das beste Instrument,<br />
wenn nicht derheutige Ausdrucksfaktor fiir Mythenbildung<br />
sind. Es hat sich gezeigt, daß eine Kunst im amatiseh-traditionellen<br />
Sinn dadurch am wenigsten erledigt war - Adornos Kritik. Den<br />
·Übergang also der Künstler von bestimmten Produktionsweisen,<br />
die Benjamin offensichtlich fiir überholt erklärt hat, in eine andere<br />
Produktionsweise hat es nicht als entmythologisierend gegeben.<br />
Ich kann jetzt nur auf das Problem verweisen: Gerade wenn das<br />
Kunstwerk gegen den originalen und überblickbaren Bestand des<br />
Werks zur sich ereignenden Vorfiihrung, zur unmittelbaren, situationslosen,<br />
wenn auch Situationellen "Zeige" verwandelt wird, die<br />
nach dem Fingerweis so verschwindet, als wäre die Spur nie in der<br />
Welt gewesen- nehmen wir etwa den Versuch, das Original als<br />
Werk zu überwinden in der Performance-, da ist die Originalität<br />
nur noch einmal radikalisiert worden bis hin zum Vollzug von einmalig<br />
bestimmten Vorgängen. Ebenso betrifft das den künstlerischen<br />
Aktionismus: bei allem Sprengen des Werks tritt Steigerung<br />
der Originalität, Einzigartigkeit der Singularität ein, nicht deren<br />
Minderung. Also hätten wir immerhin noch in der Einzigartigkeit<br />
der Begegnung die Ritualstruktur, die Be~amin formuliert hatte,<br />
eben den Begriff der Aura, nur im weiteren unüberprüfbar. Wir haben<br />
immer noch den Umstand vor uns, daß man von diesen Gegenständen<br />
ganz deutlich sagen kann, sie wollten mehr an Bedeutung<br />
hervorrufen als die positivste Beschreibung eines bzw. des<br />
Dings hergibt. Damit wäre es in der Begegnungsweise einzigartiges<br />
Objekt, dessen Existenzweise nicht in der technischen Reproduktion<br />
liegt, selbst wo solche statthatte, und dem eine Bedeutung zugewiesen<br />
wird, die über die positivistische Beschreibung des Objekts<br />
hinausragt - allerdings ohne deutende Umbildung. Insofern<br />
wäre also die Ritualstruktur wie die Mythenstruktur besonders gewährleistet.<br />
Das Problem tritt auf, ob man vielleicht an dem Standpunkt<br />
festhalten mug, Kunst könne gar nicht in the long run ohne Ritual<br />
und Mythenstruktur auskommen. Ob vielleicht die Entmythologiserungsintention<br />
in Benjamins Theorie der Medien oder<br />
Barthes' Theorie der Alltagsmythen nur als ganz situationeil gebundene<br />
Polemik aufzufassen ist, die nur gegen ihre bestimmten<br />
Gegner gelten dürfe. Es gäbe dann eine Rechtfertigung fiir produktiv<br />
werdenden Mythos durch die Entmythologisierung hindurch,<br />
nicht aus ihr zurück, wie etwa auch die Lehre neuer französischer<br />
Philosophie vom "Kairos", dem rechten Augenblick des<br />
Handelns, falsch beraten wäre, wollte sie mit dem Kairas gegen<br />
kritische Geschichtsphilosophie antreten. Gerade die dem Fingerspitzengefiihl<br />
anvertraute Schwebe des Kairas ist angewiesen auf<br />
den rahmenden Begriff seiner Einschlagsmöglichkeit, welche sich<br />
aus dem Bedingungsfeld der Geschichte ergibt. Antizipierende<br />
Vernunft nimmt der Revolution keineswegs ihre blanke Ereignis<br />
Chancetrotz des scharfsinnigen Verdachts, der darin ausgesprochen<br />
ist (die Formulierung stammt von UHrich Sonnemann). Der<br />
Anspruch des Mythos entbindet keineswegs vom Entmythologisieren,<br />
erst durch Entmythologisieren gewinnt er sein produktives<br />
Moment. So geschieht das Mögliche seiner Rechtfertigung, wenn<br />
ich davon ausgehe, daß ich in dem ganzen ästhetischen Rayon die<br />
Sinnbildung fiir menschliche Produktion sehe, im emphatischen<br />
Sinn des Horizonts auch fiir alle andere Arbeit, die unmittelbar<br />
nicht auf Ästhetisches gerichtet ist. Das heißt, ich will Kunst überschreiten,<br />
wohlgemerkt. Ich meine die Wahrnehmungssphäre<br />
und ihre Affektparallele des Lustgefiihls, des Genusses, der Befriedigung,<br />
des Vergnügens und was immer ich an Affekterwartungen<br />
. einbringen kann. Ich kann ja zu dem Standpunkt geraten, daß erst<br />
im Ästhetischen der Mensch sich verwirklicht, jenseits einer Verengung<br />
des Ästhetischen auf die Kunst und jenseits des Orientierens<br />
der Handlung durch bloße Ethik. Alle Arbeit wäre dann im<br />
Dienst einer solchen Sinnlichkeit, einer solchen Wahrnehmungswelt,<br />
die selber der Endzweck wäre. Dann könnte ich von etwas<br />
sprechen, was Nietzsche verzweifelt negativ formuliert hat in der<br />
Frage, ob sich die Welt vielleicht nurästhetisch rechtfertigen liege.<br />
Er ist darauf verfallen, weil er einsah, daß die Moral der bürgerlichen<br />
Gesellschaft nur von solcher Beschaffenheit sei, daß sie sich<br />
gerade nicht durch Selbstwerte rechtfertigen will, sondern allein<br />
immer durch Mittlerfunktionen. Er wollte mit diesem Satz das Arbeitsethos<br />
der bürgerlichen Gesellschaft angreifen, alw ein Ethos<br />
oder eine Moral, die immer nur den Wert der menschlichen Handlung<br />
in ihren Folgen sehen, also in den Zwecken, die dahinter stehen<br />
sollen, indem solche Zwecke wieder bloße Mittel werden fiir<br />
Dahinterstehendes: Reproduzierung der Gesellschaft, Selbstbehauptung<br />
der Gesellschaft als unaufhörlich sich genügender Ring.<br />
Dann steckt in dem Satz, ob die Welt vielleicht nur ästhetisch zu<br />
rechtfertigen wäre, das Beharren auf einem Selbstwert, einem<br />
Selbstzweck über das suum esse conservare hinaus. Das wäre ja<br />
nur die moralische Ausdrucksform oder Formulierungsweise fiir<br />
Ritual- und Mythenstruktur, etwas aus dem unablässig ständigen<br />
Mittelcharakter endlich einmal herauszureißen, selbst die<br />
menschliche Arbeit. Sie soll nicht immer Mittel fiir anderes sein,<br />
sondern Selbstzweck werden unter gründlichem Gestaltwandel.<br />
Da bin ich an einem Standpunkt angelangt, der unter der Formulierung<br />
des Problems einer möglichen Ästhetik als Ethik der Sinnlichkeit<br />
dann auch selbstverständlich daran festhält, daß es gar keine<br />
Befreiung der Kunst aus Ritual- und Mythenstrukturen gibt,<br />
Kunst vielmehr immer auf sie verwiesen sein wird. Ansonsten würde<br />
sie die ethische Kategorie des Selbstwerts oder Selbstzwecks<br />
menschlicher Produktion versäumen und damit die Selbstverwirklichung<br />
des Menschen. Denn in jedem Preisgeben von Selbstwert<br />
und Selbstzweck liegt ja auch die Tendenz, die Verwirklichung<br />
oder Entäußerung des Menschen zum Mittel zu machen,<br />
gerade gegen den kantischen Satz, den Menschen nie als Mittel,<br />
sondern immer nur als Zweck aufZufassen.<br />
Und doch wäre solcher Mythenrest nicht die Rückkehr des geschichtlich<br />
wirksam gewesenen Mythos, sondern immer schon<br />
bloß ein Moment an ihm, das er umgebogen hat, bevor er es stehen<br />
ließ. Er selber in seinem herrschenden Zug wendet sich auch mit<br />
dem Selbstwert seiner Figuren der Legitimation einer Herrschaft<br />
zu, die selber gezwungen ist, nur das Große-Ganze gelten zu lassen.<br />
Das "Selig sind die Zeiten", nämlich die des Homerischen,<br />
konnte nur von jemandem gesprochen werden, dem die bürgerlichen<br />
Zeiten zu viel an anarchistisch desorganisierenden Tendenzen<br />
gebracht haben, Lukäcs. Trotzdem steckt in dem gewesenen<br />
Mythos auch an Ort und Stelle ein Aufklärungskern. Diese Einsicht<br />
gipfelte schliefSlieh etwa in Harkheimcrs und Adornos "Dialektik<br />
der Aufklärung", worin der Mythos selber zu einer Weise der<br />
Aufklärung erklärt wird. Die Theologie ist hier teilweise noch etwas<br />
zurück, indem sie sich weiterhin mit dem von Bultmann zugespitzten<br />
Entmythologiserungsproblem herumschlägt. Dem hat<br />
schon Bloch eben in seinem Werk ,,Atheismus im Christentum"<br />
geantwortet: Entmythologisierung schlechthin und ohne Differenzierung<br />
im BegriffMythos sei allein darum falsch, weil es einen<br />
revolutionären Mythos gebe gegen den Herrenmythos. Und der<br />
revolutionäre Mythos sei nicht mit dem Bade auszuschütten. Rettung<br />
des Mythos trat kritisch auf mit der Wertung der Wissenschaftsgläubigkeit<br />
selber als Mythos, als mythischer Baum der<br />
Einsicht. Sie trat auf mit der Einsicht, wie sehr doch unser so<br />
höchst ernüchtertes, versachlichtes, rationales Leben von mythischen<br />
Strukturen beherrscht ist, die nur einen anderen Namen erhielten.<br />
Spuren-Alffiotzl /83