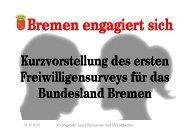Integrationsförderung durch Migrantenorganisationen
Integrationsförderung durch Migrantenorganisationen
Integrationsförderung durch Migrantenorganisationen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Reich - Vernetzung: Ein Beitrag zur Partizipation von <strong>Migrantenorganisationen</strong><br />
nehmen oder -verbände vertreten sie ökonomische<br />
Interessen, als Einrichtungen der Zivilgesellschaft ergänzen<br />
oder erweitern sie die Spielräume staatlichen<br />
Handelns. Für sie sind Migranten als Empfänger von<br />
Hilfe Klienten, als Arbeitskräfte Mitarbeiter, als Bürger<br />
Adressaten des Verwaltungshandelns, als Lernende<br />
Schüler und Schülerinnen (wie andere auch); für sie<br />
sind die Migranten als Einzelne in das Handeln der<br />
Institutionen einbezogen. Dass es zwischen der Institution<br />
und den Einzelnen Organisationen (wie die<br />
<strong>Migrantenorganisationen</strong>) geben sollte, ist zunächst<br />
einmal nicht vorgesehen.<br />
Partizipationserwartungen entstehen erst dann, wenn<br />
erkannt wird, dass die institutionelle Aufgabe in Kooperation<br />
mit <strong>Migrantenorganisationen</strong> besser bewältigt<br />
werden kann als aus eigenen Kräften.<br />
Betrachtet man das Verhältnis von <strong>Migrantenorganisationen</strong><br />
und ihren potenziellen Netzwerkpartnern<br />
unter gesellschaftlicher Perspektive, so zeigt sich<br />
das Bild eines Umbruchs, der sich vor unseren Augen<br />
vollzieht und noch nicht abgeschlossen ist, eine<br />
Gleichzeitigkeit von Altem und Neuem. Das Alte, die<br />
frühere Situation, war gekennzeichnet <strong>durch</strong> ein ziemlich<br />
beziehungsloses Nebeneinander, grob gesagt:<br />
<strong>durch</strong> das Fehlen von Netzwerken. Die Zeichen des<br />
Wandels sind aber unverkennbar:<br />
In den <strong>Migrantenorganisationen</strong> ist der Generationenwechsel<br />
vollzogen. Bei und nach den zahlreichen<br />
Neugründungen der 1990er Jahre hat eine zunehmende<br />
Neudefinition der Ziele – weg von den Problemen<br />
in den Herkunftsstaaten hin zu den Lebensbedingungen<br />
und Zukunftschancen in Deutschland<br />
– eingesetzt, die sich auch in konkreten Aktivitäten<br />
niederschlägt. Mit dem Entstehen einer „Mittelschicht<br />
mit Migrationshintergrund“ in Deutschland haben<br />
auch ökonomische, administrative und publizistische<br />
Sachkenntnisse breiteren Eingang in die <strong>Migrantenorganisationen</strong><br />
gefunden. Sie haben ihre Sache in<br />
die eigenen Hände genommen und lassen sich nicht<br />
mehr so leicht abspeisen wie in der Vergangenheit.<br />
Auf der anderen Seite bemühen sich zahlreiche größere<br />
und ältere Organisationen seit einigen Jahren<br />
schon um Kooperationen mit <strong>Migrantenorganisationen</strong>.<br />
Namentlich die Wohlfahrtsverbände sind an<br />
solchen Kooperationen interessiert, und die Politik unterstützt<br />
dieses Bestreben bei vielen Gelegenheiten;<br />
auch die heutige Veranstaltung ist ein Teil dieser politischen<br />
Unterstützung.<br />
Das alles zeigt, dass die Zeit reif dafür ist, die <strong>Migrantenorganisationen</strong><br />
als Teilhaber an einem gemeinsamen<br />
Ganzen zu sehen, in das alle gleichermaßen<br />
involviert sind. Man kann von einer sich anbahnenden<br />
„partizipatorischen Wende“ sprechen. In dem Entwurf<br />
zu einem „Bundesweiten Integrationsprogramm“,<br />
der dieses Jahr vom Bundesamt für Migration und<br />
Flüchtlinge erarbeitet worden ist, finden sich interessante<br />
Aussagen dazu. Dort heißt es im Sinne einer<br />
Zielvorgabe: „Der Stärkung von <strong>Migrantenorganisationen</strong><br />
kommt aufgrund ihres partizipations- und integrationsfördernden<br />
Potenzials hohe Bedeutung zu.“<br />
(S. 193) Und im Sinne einer kritischen Analyse des<br />
Ist-Zustands: „Eine gleichberechtigte Einbeziehung,<br />
Nutzung und Anerkennung der Kompetenzen von<br />
<strong>Migrantenorganisationen</strong> bei der Gestaltung von Integrationsangeboten<br />
sowie eine systematische Stärkung<br />
als Akteure der Integrationsförderung findet<br />
bundesweit jedoch in unterschiedlichem Umfang und<br />
nicht auf allen Ebenen programmatisch umfassend<br />
statt.“ (S. 197) Diese Linie weist in die Zukunft, sie<br />
zeigt die Aufgaben, die zu lösen sind, und sie zeigt,<br />
in welchem Geiste sie zu lösen sind. (In Klammern<br />
gesagt: Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung<br />
lässt noch nichts von diesem Geist erkennen, er<br />
beruht noch auf einer anderen Philosophie.)<br />
In welchem Sinne kann Vernetzung zu einer solchen<br />
partizipatorischen Wende beitragen? Dazu möchte<br />
ich gerne einige Beispiele aus der eingangs erwähnten<br />
Studie in Rheinland-Pfalz bringen, bei der<br />
insbesondere die Partizipation im Bereich der kommunalen<br />
Politik und im Bereich der Bildung untersucht<br />
worden ist.<br />
Im Bereich der Bildung sind wir auf drei interessante<br />
Felder möglicher Partizipation und Vernetzung gestoßen<br />
– die außerschulische Förderung, die interkulturelle<br />
Bildung und den islamischen Religionsunterricht.<br />
Außerschulische Förderung, vor allem in den Fächern<br />
Deutsch, Mathematik und Englisch, wird inzwischen<br />
von zahlreichen <strong>Migrantenorganisationen</strong>, besonders<br />
auch solchen mit religiöser Zielsetzung, angeboten.<br />
Die religiös orientierten Organisationen ergänzen<br />
dieses Angebot auch <strong>durch</strong> Bildungsangebote in den<br />
Herkunftssprachen und <strong>durch</strong> religiöse Unterweisung.<br />
Man darf dies aber keineswegs dahingehend missverstehen,<br />
als ob die schulbezogenen Angebote bloße<br />
Einstiegsangebote für die identitäts- und herkunftsbezogenen<br />
Angebote wären. Im Gegenteil: Der Bildungserfolg<br />
der Kinder und Jugendlichen in Deutschland<br />
steht im Vordergrund dieser Bemühungen; diese<br />
orientieren sich konsequenterweise an den fachlichen<br />
Erwartungen der deutschen Schule. Das wäre eine<br />
gute Grundlage für Kooperation. Die in Rheinland-<br />
Pfalz kontaktierten Einrichtungen dieser Art geben<br />
BBE - Dokumentation 11